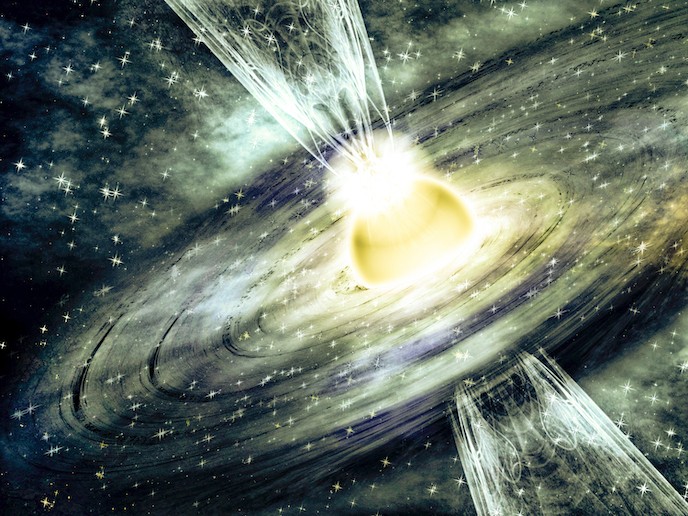EU-Forschung stellt sich den großen ungeklärten Fragen des Universums
Das Wechselspiel von Materie und Antimaterie treibt nicht nur das Raumschiff Enterprise in Star Trek an, sondern auch die Suche nach Antworten auf offene Fragen. Im EU-Projekt ANGRAM wurde dafür jetzt eine neue Methode getestet, mit der Antimaterie nachgewiesen werden kann, und es wurden Fortschritte in der Frage erzielt, wie Antimaterie fällt. Die über das Marie Skłodowska-Curie-Programm geförderte Forschungsstipendiatin Angela Gligorova hat Antiprotonen simuliert – und nachgewiesen – um deren Wechselwirkungen mit normaler Materie zu untersuchen. Noch analysiert und vergleicht Gligorova ihre Daten, hofft aber in den nächsten Monaten ihre Ergebnisse veröffentlichen zu können. „Unsere Untersuchung basierte auf der Annihilation von Antiprotonen in verschiedenen Materialien, um so bestehende Modelle der Physik zu validieren und ihre Schwächen, aber dann auch Verbesserungsmethoden, zu finden“, so Gligorova. Die ersten Ergebnisse aus ANGRAM zeigen, dass keines der gängigen physikalischen Modelle die Wechselwirkung zwischen Materie und Antimaterie adäquat beschreibt. „Die Forschungsarbeiten haben einige Aspekte der Wechselwirkung klarer gemacht und uns gezeigt, dass in dieser Richtung noch einiges an Arbeit nötig ist“, sagt Gligorova. Unter Anleitung von Eberhard Widmann, Leiter des Stefan-Meyer-Instituts für subatomare Physik an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, sicherte sich Gligorova wertvolle Forschungszeit an der Europäischen Organisation für Kernforschung, dem CERN, und dem dortigen Antiprotonen-Entschleuniger, der die Antiprotonen für die Bildung von Antiwasserstoff erzeugt. Doch die Stipendiatin konnte ihre Arbeit nicht abschließen: Sie wollte noch eine 30 %-Messung der Fallbeschleunigung des Antiwasserstoffs durchführen, doch der Antiprotonen-Strahl im CERN ist begehrt und steht jedem nur für begrenzte Zeit zur Verfügung. Die neue Bildung des Antiwasserstoffs dauerte zudem länger als vorhergesehen. „Am Ende war keine Zeit mehr, um die Fallbeschleunigung zu messen“, erklärt Gligorova. „So ein Versuchsergebnis ist wichtig, weil es den wahren Grund dafür liefern könnte, dass es im Universum so viel mehr Materie als Antimaterie gibt, obwohl ganz am Anfang, beim Urknall, beide in der gleichen Menge entstanden sein müssten.“
Die Schönheit von Rückschlägen
Im Projekt wurde ein Moiré-Deflektometer getestet, um den Fall von Antiwasserstoff im Gravitationsfeld der Erde zu simulieren. Das ist ein System aus zwei oder drei parallelen Gittern, die an einen Detektor angebaut werden. Gligorova entdeckte, dass die Wechselwirkungen zwischen den Antiwasserstoffatomen, die nahe an den Gittern vorbeikamen, und den Atomen der Gitter einen Effekt erzeugten, der beim Versuch, die Schwerkraft zu messen, in die Irre führte. Daraus schloss Gligorova, dass für die Tests ein noch komplexeres Deflektometer nötig wäre, das aus Licht statt aus Materie besteht, doch so ein Instrument ging weit über die vorhandenen Ressourcen hinaus. „In der Forschung läuft nicht immer alles wie geplant und darin liegt gerade die Schönheit. Und das sorgt auch für Fortschritt“, ergänzt Gligorova optimistisch. Von Gligorovas Arbeit in diesem anspruchsvollen Bereich und dem Video, das sie zum Internationalen Frauentag erstellt hat, haben sich bereits junge Nachwuchsforscherinnen inspirieren lassen. Zukünftige Experimente mit Antimaterie könnten auf der in ANGRAM entwickelten Kombination von zwei Detektortechnologien für die Annihilation von Antiprotonen aufbauen. „In unserer Studie wurden erstmals experimentelle Daten und gängige physikalische Modelle für die Antiproton-Kern-Annihilation im Ruhezustand direkt miteinander verglichen, und wir konnten daran sehen, wie gut oder schlecht die Vorhersagen für den Niedrigenergiebereich waren“, so Gligorova abschließend.
Schlüsselbegriffe
ANGRAM, Antimaterie, Antiwasserstoff, Antirprotonen, Deflektometer, Star Trek