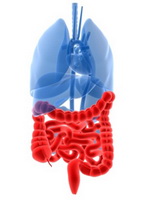Interaktion zwischen Mikroben und Genen bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung
IBD gehören zu jenen Erkrankungen, bei denen Umweltfaktoren vor allem auch in Kombination mit einer komplexen genetischen Anfälligkeit eine Rolle spielen. Obwohl die mikrobielle Darmflora die Ätiologie der Erkrankung in erheblichem Maße beeinflusst, sind die entsprechenden Mechanismen noch nicht gänzlich geklärt. Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Proteasen und Proteaseinhibitoren (P/PI) am Entzündungsgeschehen in der Darmschleimhaut beteiligt sind. Um weitere Erkenntnisse zur Funktion von P/PI bei menschlichen IBD zu erlangen, analysierte IBDASE die Genotyp-Phänotyp-Korrelation an europaweiten IBD-Patientenkohorten. Zuerst prüfte das Konsortium alle veröffentlichten Studien zu genetischen Ursachen von IBD und allen IBD-assoziierten P/PI-Genen, gefolgt von Gensequenzierungen und genetischen Assoziationsstudien an mehr als 2.000 Patienten mit Morbus Crohn und 2.000 Patienten mit Colitis ulcerosa (chronischer Dickdarmentzündung). Die Ergebnisse wurden anschließend mit denen von fast 1.800 gesunden Kontrollpersonen verglichen. Analysiert wurden die Expression möglicher P/PI-Gene und immunrelevante Gene in klinischen Proben und Tiermodellen für IBD. Die Expressionsmuster bei drei IBD-Modellen legten eine unterschiedliche, für jedes IBD-Modell spezifische proinflammatorische Gensignatur nahe. Zwei molekulare Signalwege waren allen Modellen gemeinsam, und zwar das Komplementsystem und das Protease-Ubiquitin-System. Diese Signalwege wurden auch bei den P/PI-Genen mit ausgeprägtestem genetischen Befund für menschliche IBD identifiziert. Darmmikroben kommt eine wichtige immunregulatorische und homöostatische Funktion zu, wie das Konsortium nachwies, und eine Defizienz mikrobiell induzierter Gene begünstigt Entzündungsprozesse im Darm. Ein weiterer pathogenetischer Faktor ist die Interaktion zwischen einem der P/PI-Kandidatengene - Meprin - und dem mit Morbus Crohn assoziierten Bakterienstamm LF82. An Tiermodellen mit spezifischen P/PI-Defizienzen wurde die Rolle der viel versprechendsten P/PI-Kandidatengene und assoziierter molekularer Signalwege validiert. Insgesamt wies das IBDASE-Projekt eine protektive Rolle der mukosalen proteolytischen Barriere für die Darmflora nach. Die Modulation der P/PI-Aktivität in Kombination mit der Manipulation bestimmter immunassoziierter Signalwege ist ein möglicher therapeutischer Ansatz für IBD. Die komplexe Natur dieser Erkrankungen beim Menschen fordert aber weitere Forschungen auf individueller Ebene, um die pathogenen Mechanismen der Krankheitsentstehung am einzelnen Patienten genauer zu klären.