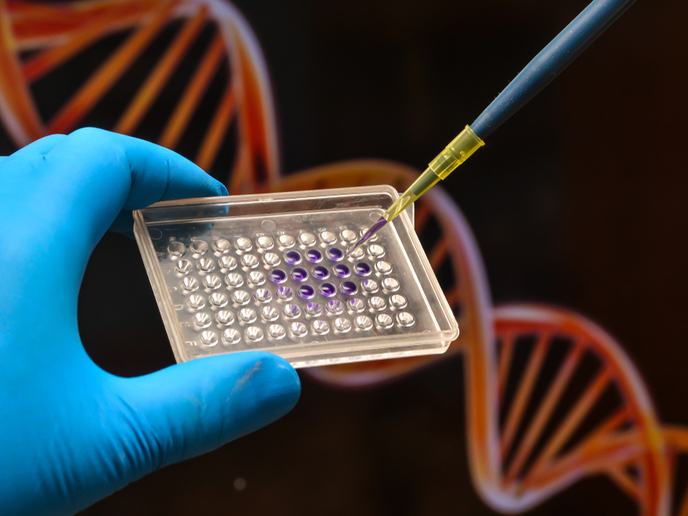Rückenwind für die Metagenomikforschung in Europa
Durch das Aufkommen von leistungsfähigeren und kostenwirksameren DNA-Sequenzierungstechnologien haben sich die Studien im Bereich Genentdeckung und -charakterisierung ausgeweitet: von Einzelorganismen über Mikrobiome bis hin zu Gemeinschaften komplexer Wirbelloser und Wirbeltiere. Aus Metagenomen gewonnene Erkenntnisse mehren unser Wissen über den Reichtum und die relative Häufigkeit von Arten (Erhebung der biologischen Vielfalt), über die Art und Weise, wie sich Arten in unterschiedlichen Lebensräumen verteilen (Artensortierung), sowie über ihre Rolle in Nahrungsnetzen. Zudem werden verschiedene Organismen zur Überwachung von Veränderungen in der Umwelt herangezogen. Sie dienen somit als hervorragende Modelle zur Veranschaulichung biologischer Wechselwirkungen und evolutionären Wandels. Das EU-finanzierte Projekt EnvMetaGen wurde ins Leben gerufen, um die Forschung und die technischen Kapazitäten am InBIO zu verbessern und dadurch die Forschungsqualität und -leistung im Bereich Metagenomik zu steigern. Dank dem Finanzierungsmechanismus konnte das Institut ein Team aus mehreren internationalen Forschern sowie Forschern portugiesischer Herkunft, die das Land verlassen hatten, zusammenstellen. Bis dato ist es dem InBIO gelungen, eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit zwölf Organisationen und Einrichtungen in ganz Europa aufrechtzuerhalten. Vergleichssammlung zu Insektenarten Eine bedeutende Projektleistung bestand in der Einführung der InBIO-Barcoding-Initiative – einer Kampagne zur Erfassung von DNA-Barcodes wirbelloser Taxa innerhalb Portugals. Bislang hat das Forscherteam tausende Arten Wirbelloser dem Barcoding-Verfahren unterzogen, darunter insbesondere Insekten, einschließlich landwirtschaftlicher und forstlicher Schädlinge, neuer exotischer Arten, die in Europa auftreten, und wissenschaftlich noch unerforschter Spezies. Diese Initiative ist deshalb so bedeutend, da es keine umfassenden Vergleichssammlungen – besonders in Bezug auf wirbellose Taxa – im Mittelmeerbecken mit seiner reichen biologischen Vielfalt gibt. Dies erschwert die Anwendung von metagenomischen Ansätzen in der Biodiversitätsforschung. Beispielsweise ermöglichte die Initiative das Barcoding mehrerer höchst vielfältiger Wasserinsektenarten wie der Eintagsfliege, Steinfliege, Köcherfliege, Libelle und Wasserjungfer, für die keine Barcodes vorhanden waren. „Diese in Süßwasserhabitaten vorkommenden Insekten verbringen ihr Larvenstadium unter Wasser. Durch ihre hohe Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen in der Umwelt sind sie hervorragende Indikatoren für die Gesundheit des aquatischen Ökosystems“, erläutert Projektkoordinator Dr. Pedro Beja. Vorteile der Metagenomik Die Analyse von Umwelt-DNA durch Metagenomik ist eine einfache Methode, um Organismen zu studieren, die kaum greifbar oder auch gefährdet sind – ohne sie dabei anthropogenen Stressfaktoren auszusetzen. Darüber hinaus können auf diese Weise Arten im frühen Stadium der Invasion, wenn sie noch in geringer Populationsdichte vorzufinden sind, entdeckt werden. Die Metagenomik ist außerdem ein leistungsstarkes Instrument zur Prüfung der biologischen Vielfalt innerhalb eines Lebensraums. Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich das Forscherteam auf verbesserte Methoden zur Isolierung und Extraktion von DNA für die Metabarcoding-Analyse kleinerer trüber Gewässer in Trockengebieten. Die Ergebnisse sind für die Erhebung der biologischen Vielfalt überaus relevant, da diese Gewässer normalerweise verschiedene Arten von Wirbeltieren in großer Zahl aufweisen. Im Mittelpunkt einer weiteren Studie stand die Frage, wie durch die Verwendung von Konservierungsstoffen für Wasserproben, z. B. durch Ethanol, das DNA-Metabarcoding von Makroinvertebraten verbessert werden kann. „Die Gewinnung von Arten-DNA aus Wasserproben bietet ein wirksames und kostengünstiges Verfahren zur Überwachung von Verschlechterungen in der aquatischen Umwelt“, führt Dr. Beja aus. EnvMetaGen nutzt außerdem die Möglichkeiten der Metagenomik, um ein genaueres Verständnis der Ernährungsgewohnheiten zu erhalten. Dazu werden DNA-Fragmente aus dem Kot von Fledermäusen, Vögeln und anderen Wirbeltieren isoliert. „Durch die Ermittlung und Quantifizierung trophischer Verbindungen zwischen den Arten sind wir in der Lage, detailliertere und komplexere Nahrungsnetze als je zuvor zu bauen“, so Dr. Beja abschließend. „So könnten etwa tiefer greifende Erkenntnisse zu den Wechselwirkungen zwischen Räubern und landwirtschaftlichen Schädlingen dabei helfen, den Einsatz von Pestiziden in den landwirtschaftlichen Betriebssystemen in Europa zu drosseln.“ Die Projektergebnisse wurden bereits in zahlreichen Artikeln in Fachzeitschriften publik gemacht. Darüber hinaus wird durch die Beteiligung an mehreren Konferenzen und die Organisation von Workshops gewährleistet, dass die wertvollen Ergebnisse weiter verbreitet werden.
Schlüsselbegriffe
EnvMetaGen, Metagenomik, biologische Vielfalt, Biodiversität, InBio, Wirbellose, Nahrungsnetz, aquatische Umwelt, DNA-Barcode, DNA-Metabarcoding