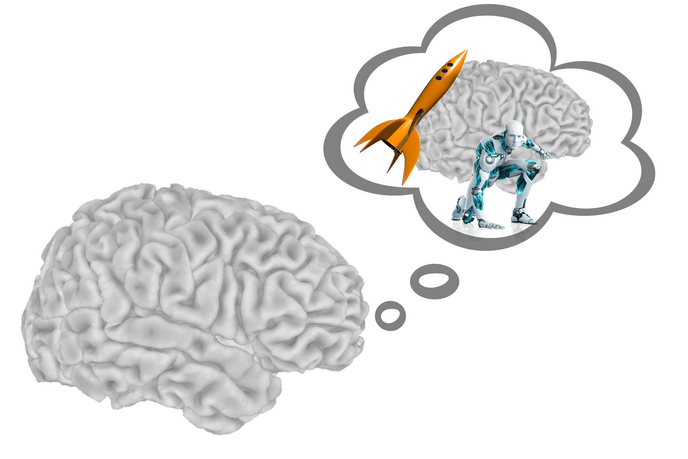Neues zur Metakognition bei Entscheidungsprozessen
Immer muss man sich entscheiden ... Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass sie von morgens bis abends Entscheidungen treffen. So muss in vielen Situationen die jeweils geeignete Option ausgewählt werden. Diesen Entscheidungen liegen meist frühere Erfahrungen zugrunde, die wiederum die Basis für Vorhersagen kommender Ereignisse sind. Dabei werden in Sekundenschnelle die Folgen möglicher Handlungen durchgespielt, sodass entsprechend und angemessen reagiert werden kann. In vielen Situationen kommt es dabei auf die sogenannte Metakognition an, also die Fähigkeit, die Qualität einer Entscheidung richtig einzuschätzen. Die eigene Leistung oder Entscheidungsfähigkeit korrekt zu beurteilen, ist in vielen Bereichen des (Berufs-)Lebens unerlässlich.
Verhaltenssteuerung durch Erinnerungen
Um herauszufinden, wie das Gehirn die Folgen einer Entscheidung richtig bewerten kann, entwickelte das EU-finanzierte Projekt Meta_Mind mehrere Versuchsreihen, in denen Teilnehmende verschiedenste Entscheidungen treffen sollten. „In unseren Experimenten wandten wir neue Methoden der Musteranalyse und Hirnstimulation an, um Gehirnsignale aus fMRT- und EEG-Scans auszuwerten. Diese wurden aufgezeichnet, während das Gehirn eine Entscheidung treffen und die Folgen des eigenen Verhaltens bestmöglich abschätzen sollte“, erklärt Martijn E. Wokke, Forschungsleiter von Meta_Mind, Finanziert wurde das Projekt über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen. Wokke erläutert dies an einem gut nachvollziehbaren Beispiel. Betritt man einen unbekannten Supermarkt, um etwa eine Schokolade zu kaufen, ist die Waschmittelabteilung für die meisten Menschen irrelevant. Nähert man sich jedoch den Keksregalen, fokussiert sich nach und nach die Aufmerksamkeit. Ohne genau zu wissen, wo sich die Schokoladenregale befinden, weiß das Aufmerksamkeitssystem aber schon aufgrund früherer Erfahrungen (typische Aufteilung in Supermärkten), welche sensorischen Inputs wichtig sind, um die Schokolade zu finden. Diesem Beispiel zufolge steuern also nicht nur externe offensichtliche Informationen, sondern auch interne Prozesse (Erinnerungen) auf effiziente Weise das Verhalten im Alltag.
Analyse von Metakognition bei Entscheidungsprozessen
Trotzdem kann diese Prognosefähigkeit auch nachlassen, etwa bei Müdigkeit. Bei Schizophrenie oder bestimmten Suchterkrankungen kann sie sogar stark beeinträchtigt sein, oft mit sehr nachteiligen Folgen. Laut einem von Wokke mitverfassten Forschungsbeitrag können mittels Metakognition aktuelle Verhaltensweisen angepasst und, wenn externe Feedbacks fehlen, künftige Entscheidungen überdacht werden. Obwohl Metakognition für viele Alltagssituationen so enorm wichtig ist, ist noch ungeklärt, welche Informationen tatsächlich überwacht werden, und welche Art von Information die Basis für metakognitive Entscheidungen ist. Nachdem das Gehirn mehrmals bestimmte Abfolgen von Handlung-Ergebnis bzw. Kontext-Ergebnis durchgespielt hat, kann es, wie das Projekt zeigt, diese anfänglich äußerlichen Prozesse „verinnerlichen“ und dann Verhalten effektiver steuern. Dabei ist offenbar vor allem der präfrontale Kortex wichtig, da er künftige Ereignisse intern vorhersehen und ein „metakognitives Bewusstsein“ über die Interaktionen zwischen Individuum und Außenwelt herstellen kann. Wurde jedoch in den Versuchsreihen die neuronale Aktivität in (anterioren) präfrontalen Gehirnarealen mittels transkranieller Magnetstimulation kurzzeitig unterbrochen, ließ die Voraussagefähigkeit nach. Dann konnten prädiktive Informationen in der Umgebung (Kontextinformationen) auch kaum für Prognosen künftiger Ereignisse genutzt werden. „Diese Ergebnisse könnten aufschlussreich sein, um suboptimale Entscheidungsprozesse im Alltagsverhalten und im klinischen Setting zu verstehen“, schließt Wokke.
Schlüsselbegriffe
Meta_Mind, Entscheidungsfindung, Metakognition, Musteranalyse, Gedächtnis, Vorhersage, Bewusstsein