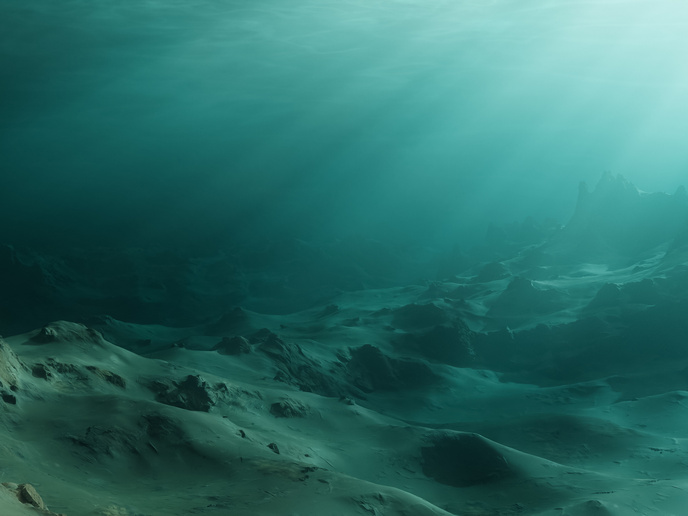Mineralien – Schlüssel zur Freisetzung von blauem Kohlenstoff?
Blauer Kohlenstoff, d. h. Kohlenstoff, der in Küsten- und Meeresökosystemen einschließlich Meeresbodensedimenten, gespeichert ist, übernimmt bekanntermaßen eine wichtige Aufgabe bei der Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels. Es ist jedoch nicht ganz klar, auf welche Weise bei organischem Kohlenstoff, der von einst lebenden Organismen stammt, verhindert wird, dass er von Mikroben abgebaut wird, und wie er sich über Jahrmillionen im Sediment festsetzen kann. „Allein die Tatsache, dass überhaupt organischer Kohlenstoff erhalten ist, ist äußerst rätselhaft“, erläutert die Koordinatorin des Projekts MINORG, Caroline Peacock, Professorin für Biogeochemie an der School of Earth and Environment der University of Leeds im Vereinigten Königreich. „Mit unserem Projekt wollten wir herausfinden, was die Ursache für die Ablagerung von Kohlenstoff im Sediment ist und welche Bedeutung die Mineralien für diesen Ablagerungsprozess haben.“ „Das ist wichtig, weil die Einlagerung von Kohlenstoff in Sedimenten dazu beiträgt, das langfristige Klima auf der Erde zu regulieren“, erklärt sie. „Über lange Zeiträume hinweg wird durch die Ablagerung von organischem Kohlenstoff in Sedimenten auch Sauerstoff in der Atmosphäre angereichert.“ Aber selbst über kürzere Zeiträume hinweg „wird jedes bisschen Kohlenstoff, das in Sedimenten eingelagert ist, bis zu einem gewissen Grad von der Atmosphäre ferngehalten.“
Mit Experimenten Mineralverbindungen bestimmen
Im Labor wurden den in Meeressedimenten vorkommenden ähnliche Mineralien synthetisiert, um die Mechanismen zu untersuchen, durch die sich verschiedene Arten von in der Meeresumwelt vorkommendem Kohlenstoff mit Mineralien verbinden. „Wir haben genau betrachtet, wie ein bestimmtes Kohlenstoffmolekül an eine Mineraloberfläche gebunden wird“, legt Peacock dar. Es hat sich erwiesen, dass Mineralien in Meeressedimenten, und insbesondere aus Eisen und Mangan bestehende Mineralien, organischen Kohlenstoff binden und ihn vor dem Abbau schützen. Auch Veränderungen von Temperatur, Salzgehalt, pH-Wert und weiteren Parametern wurden im Labor untersucht und quantifiziert. Peacock dazu: „Wir wollten die Stabilität dieser Bindungsmechanismen verstehen, beispielsweise, ob sie überleben, wenn sie im Sediment abgelagert werden, oder ob sie verschiedene chemische oder biologische Veränderungen überstehen, die während der Einlagerung auftreten.“ „Unsere wichtigste Schlussfolgerung lautete, dass die wichtigste Art von Kohlenstoff im Zusammenhang mit Konservierung und Einlagerung der carboxylreiche Kohlenstoff ist“, merkt sie an. Er stammt aus dem Abbau von marinem Phytoplankton. „Carboxyl-Kohlenstoff ist stark mit Mineralien verbunden, weil die Anziehungskräfte zwischen Kohlenstoff und Mineralien sehr hoch sind und über biologische Veränderungen hinweg bestehen bleiben, und das wahrscheinlich über einen langen Zeitraum in der Erdgeschichte hinweg.“
Biogeochemisches Modell simuliert Meeresboden
Im Rahmen des vom Europäischer Forschungsrat finanzierten Projekts wurde ein Vorhersagemodell von Null an entwickelt. „Wir haben all diese aufgezeichneten Prozesse in einem biogeochemischen Modell, einer Art Simulation des Meeresbodens, zusammengefasst, mit dem wir den Kohlenstoffkreislauf zwischen Sedimenten und Meerwasser vorhersagen können“, erklärt Peacock. „Unser Modell zeigt, dass rund 60 % des eingelagerten Kohlenstoffs mit Mineralien wie etwa Eisen- und Manganmineralien in Verbindung stehen, die sich im modernen Ozean nicht von Ort zu Ort oder gar über lange Zeiträume hinweg verändern können.“ "Wenn die Eisenverfügbarkeit die Kohlenstoffeinlagerung steuert, dann wird die Kohlenstoffeinlagerung variieren, denn wir wissen, dass sich die Eisenverfügbarkeit im Laufe der Erdgeschichte dramatisch verändert hat“, erklärt sie und weist darauf hin, „dass dies große Auswirkungen auf das Klima, die Sauerstoffversorgung und sogar die biologische Evolution hat.“
Geopolymerisation
Im Zuge des Projekts wurde außerdem festgestellt, dass sich der Kohlenstoff im Sediment unter bestimmten Umständen in eine stark nichtreaktionsfähige Art von Kohlenstoff umwandelt. „Wir nennen es Geopolymerisation, bei der relativ einfache Formen von Kohlenstoff polymerisiert werden und sich zu viel größeren Molekülen verbinden, die sehr stabil sind“, sagt Peacock. „Wir haben Modelle erstellt, aus denen hervorgeht, dass die Temperaturen an der Erdoberfläche ohne die Einlagerung von geopolymerisiertem Kohlenstoff wahrscheinlich ganz anders in Erscheinung getreten wären, und dass auch die Sauerstoffanreicherung auf unserem Planeten über viele, viele Millionen Jahre hinweg anders erfolgt wäre. Das war schon eine ziemlich große Sache“, fügt sie hinzu. Während im Mittelpunkt des Projekts die Frage stand, wie diese Prozesse den Planeten im Lauf der Erdgeschichte geformt haben, stellt Peacock fest, dass ein Interesse daran besteht, diese Prozesse zu manipulieren, um zukünftig eine Verbesserung der Bestände an blauem Kohlenstoff zu erreichen.
Schlüsselbegriffe
MINORG, blauer Kohlenstoff, Meeressediment, Sediment, Klima, Eisen, Mangan, Carboxyl-Kohlenstoff, biogeochemisches Modell, Meeresboden, Kohlenstoffkreislauf, Evolution, Geopolymerisation