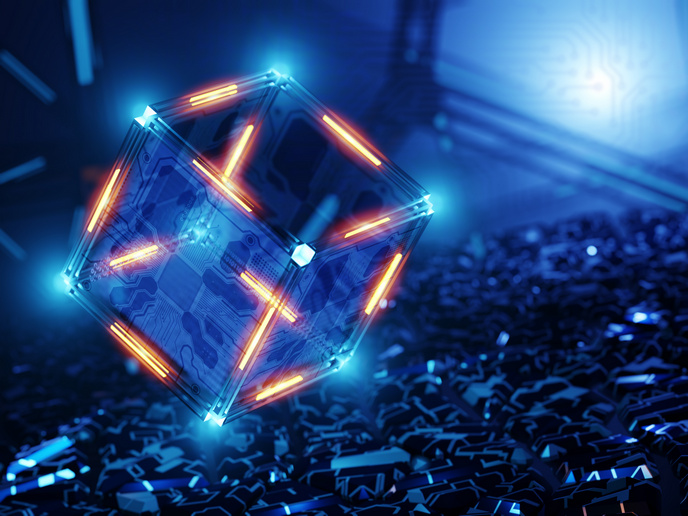Ein neuer Ansatz für den Erhalt digitaler Inhalte
Die zunehmende Digitalisierung von Inhalten ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist unbestritten, dass der sofortige Zugang zu einer schwindelerregenden Menge an Informationen ermöglicht wird. Dies geht jedoch mit erheblichen Nachteilen einher: Im Gegensatz zu Büchern sind digitale Inhalte meistens kurzlebig. Das digitale Ökosystem entwickelt sich so schnell – einschließlich von Veränderungen in Bezug auf politische Maßnahmen, gesetzliche Rahmenbedingungen, branchenübliche Praktiken, Nutzererwartungen und -verhaltensweisen oder Semantik –, dass der langfristige Zugang zu Inhalten nicht immer garantiert werden kann. An dieser Stelle kommt das über das Projekt PERICLES (Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics) unterstützte „preservation by design“-Konzept ins Spiel. „‚Preservation by design‘ bedeutet, dass die Bewahrung kein ‚nachträglicher Einfall‘ oder eine Maßnahme ist, die nach dem ‚aktiven Leben‘ eines digitalen Objekts fällig wird“, sagt Dr. Marc Hedges, Senior Lecturer am Fachbereich für Geisteswissenschaften des King's College London und Koordinator von PERICLES. „Dieser auf die Verwahrung folgende Ansatz beinhaltet ein proaktives und nicht nur ein reaktives Management digitaler Assets, bei dem der Erhalt ein Bestandteil des aktiven Lebens eines Objektes ist.“ Bei einem solchen Ansatz durchläuft ein Objekt, das als ‚lebendig‘ gilt, solange es nicht vollständig gelöscht worden ist, unterschiedliche Phasen oder es hat mehrere Leben. „Der integrierte Datenerhalt wäre Bestandteil der gesamten Datenlebensdauer, von der Erstellung bis zur Löschung“, merkt Dr. Hedges an. Über die Technik für den Datenerhalt hinausgehen Bestehende Ansätze für den Datenerhalt sind typischerweise ausschließlich auf die technische Umgebung fokussiert, die für eine langfristige Archivierung notwendig ist. Auch wenn in Literatur und Normen hervorgehoben wird, dass solche Archive nicht nur an technische, sondern auch an organisatorische Zwecke gebunden sind, neigen Institutionen dazu, den technischen Aspekten zu große Bedeutung beizumessen. PERICLES verfolgt einen anderen Ansatz: Es wird untersucht, wie sich Veränderungen eines Elements der Umgebung seien es Nutzergemeinschaften, die Institution selbst oder der größere gesellschaftliche und kulturelle Kontext auf die Nützlichkeit und Auslegung des digitalen Objekts auswirken und wie solche Veränderungen verwaltet werden können. „Ein Ziel von PERICLES war es, die Hypothese zu untersuchen, dass es möglich ist, die Auswirkungen einer Veränderung in Bezug auf den Zugang und die Wiederverwendbarkeit eines Objekts zu analysieren sowie geeignete Linderungsmaßnahmen vorzunehmen, wenn wir die Dependenzen eines spezifischen Objekts innerhalb seines Ökosystems und die resultierenden Modelle und Ontologien in eine Infrastrukturschicht implementieren können“, sagt Dr. Hedges. Vor diesem Hintergrund entwickelte das Team einen Framework und eine Architektur für die Integration. Es sollen Workflows und Komponenten demonstriert werden, welche die Einführung einer Veränderungsmanagement-Schicht in bestehende Repository-Systeme ermöglichen. Es wurden Prüfstände entwickelt, um die Gültigkeit des Ansatzes bei verschiedenen Szenarien zu verifizieren. „Komponenten, die wir nicht auf dem Markt finden konnten, haben wir selbst entwickelt“, erklärt Dr. Hedges. „Hierzu zählen beispielsweise Domänenontologien und Ökosystemmodelle, ein wichtiger Umgebungsinformations-Extractor und weitere Tools zum Einpflegen der Ontologien, ein Entitätenverzeichnis in Kombination mit einem Modell-Repository, ein Prozess-Compiler, ein Beurteilungs-Tool, ein Richtlinieneditor usw.“. Andere Komponenten können ebenfalls berücksichtigt werden, solange diese den von dem PERICLES-Integration-Framework festgelegten Rollen entsprechen. Zur Validierung des Ansatzes war es erforderlich, dass Dr. Hedges und sein Team auf komplexe Daten zurückgriffen, wobei zwei Domänenontologien im Fokus standen: Digitale Kunst und Medien sowie Weltraumforschung. „Die Institutionen, die diese Daten verwalten, scheinen in Bezug auf die Zuständigkeiten komplett gegensätzliche Positionen einzunehmen. Das TATE-Netzwerk zielt auf den Erhalt digitaler Kunstsammlungen und auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Fachkenntnisse im Bereich des Datenerhalts ab, wohingegen das Weltraum-Operationszentrum B.USOC einen Sektor repräsentiert, in dem der Erhalt größtenteils auf die Aufbewahrung beschränkt ist. Andererseits ist die ,Wiederverwendung‘ im Bereich der Kunst kein gängiges Konzept, während diese Idee in der wissenschaftlichen Domäne ein rasantes Wachstum verzeichnete“, sagt Dr. Hedges. Zu den spannendsten Projektergebnissen zählt laut Dr. Hedges, dass das Wissen in Bezug auf die Dependenzen eines Objekts und seines Ökosystems aus einer Kombination verschiedener Fachkenntnisse resultieren. Die Übertragung dieser Erkenntnisse in semantische Modelle und Ontologien, die für Mensch und Maschine verständlich sind, ermöglicht eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen beiden Akteuren. „Dies macht eine neue Allianz zwischen menschlicher Fachkraft und technologischem System erforderlich, bei der der menschliche Akteur beispielsweise durch die Eingabe von Informationen in Modelle und durch das Treffen von Entscheidungen, die auf dem System basieren, eine aktive Rolle einnimmt“, schwärmt Dr. Hedges. „Von einer Vorstellung, in der Technologie als Misstrauen erweckender Helfer oder als Zauberstab erscheint, der alles von selbst macht, sind wir weit entfernt.“ Ein Blick in die Zukunft Auch wenn die Forschung in ihrem aktuellen Stand sehr experimentell ist, werden Fluglinien, Krankenhäuser sowie Finanz- und Staatsorganisationen, die mit verschiedenen digitalen Assets umgehen und die den Zugang zu diesen Assets über einen langen Zeitraum aufrecht erhalten möchten, sicherlich an der PERICLES-Forschung interessiert sein. Im April wird das Team ein Weißbuch veröffentlichen, in dem der Ansatz abgesehen von Organisationen, die hauptsächlich mit dem Datenerhalt beschäftigt sind, auch anderen Organisationen beschrieben wird, die nach wie vor Herausforderungen in dieser Hinsicht gegenüberstehen. „Parallel dazu haben wir an der Schaffung eines Portals namens PRESERVEWARE – einem Hub für die digitalen Bewahrung – gearbeitet, das Menschen beim Finden geeigneter Bewahrungs-Tools, einschließlich der im Zuge von PERICLES hergestellten Tools, unterstützen soll“, erklärt Dr. Hedges. „Wir haben bestehende Verzeichnisse betrachtet und glauben, auch wenn diese ausgezeichnet sind, dass Fachkräfte, die nach Tools suchen, je besser das Gebiet abgedeckt ist, umso höhere Chancen haben werden, diese tatsächlich zu finden.“