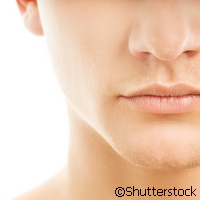Wissenschaftler enthüllen, weshalb der menschliche Geruchssinn so schlecht ist
Ein europäisches Team aus Wissenschaftlern hat entdeckt, dass der Riechkolben, ein Bereich des Gehirns bei Wirbeltieren, der die Sinneseindrücke von der Nase verarbeitet, beim Menschen anders geartet ist. Er unterscheidet sich von dem Riechkolben aller anderen Säugetiere, weil sich in diesem Bereich nach der Geburt keine neuen Neuronen mehr entwickeln. Diese Entdeckung gibt Aufschluss darüber, warum die Menschen nicht so einen ausgeprägten Geruchssinn haben wie die Tiere. Die Studie wurde teilweise durch ein Stipendium des Europäischen Forschungsrats (ERC) unter dem Siebten Rahmenprogramm der EU (RP7) finanziert und kam in der Fachzeitschrift Neuron zur Veröffentlichung. Geleitet wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit Forschern aus Frankreich, Österreich und Schweden vom Karolinska Institutet in Schweden. Bei erwachsenen Säugetieren werden neue Neuronen in zwei Bereichen des Gehirns gebildet: Im Hippocampus und im Riechkolben. Das Gedächtnis ist mit dem Hippocampus verbunden und die Interpretation von Gerüchen mit dem Riechkolben. Trotz aller Versuche, unser Wissen über die Bildung neuer Nervenzellen im menschlichen Gehirn zu erweitern, wurde bisher keine klare Antwort gefunden. Nun jedoch konnten die Forscher dieser Studie das Rätsel lösen, indem sie das Alter der Zellen schätzten. Zu diesem Zweck maßen sie, wie viel radioaktives Kohlenstoff-14-Isotop in diesen Zellen enthalten ist. Kohlenstoff-14 ist ein natürliches Radioisotop, das in organischen Materialien vorkommt und somit bei der Zellentstehung in die DNS eingearbeitet wird. Der Abbau von Kohlenstoff-14 dient als Datierungsmethode. Die Wissenschaftler beobachteten, dass die Neuronen im Riechkolben eines erwachsenen Menschen Kohlenstoff-14-Werte aufwies, die denen in der Atmosphäre zum Zeitpunkt der Geburt entsprachen. Daraus lässt sich schließen, dass in diesem Teil des Gehirns keine neuen Neuronen produziert werden, was den Menschen von anderen Säugetieren unterscheidet. "Nie zuvor hat mich eine wissenschaftliche Entdeckung dermaßen überrascht", erklärt der leitende Forscher Jonas Frisén, Professor für Stammzellenforschung der Tobias-Stiftung am Karolinska Institutet, der für seine Arbeit auch ein Stipendium des Europäischen Forschungsraums erhielt. "Man könnte meinen, dass der Mensch in dieser Hinsicht wie jedes andere Tier, insbesondere wie der Menschenaffe, funktioniert. Der Mensch ist für sein Überleben weniger abhängig von seinem Geruchsinn als andere Tiere, was mit dem Verlust der Produktion neuer Zellen im Riechkolben zusammenhängen könnte, doch das ist pure Spekulation." Bisher dachten die Forscher, Neuronen im Gehirn würden sich nur bis zum Zeitpunkt der Geburt bilden und nicht mehr danach. Später jedoch entdeckten Experten, dass sich in den Stammzellen im Gehirn von Säugetieren auch nach der Geburt noch Nervenzellen bildeten. Daraufhin änderten die Forscher ihre Ansicht über die Plastizität des Gehirns und eröffneten die Möglichkeit, Nervenzellen, die infolge verschiedener neurologischer Erkrankungen zerstört worden waren, ersetzen zu können. Weitere finanzielle Mittel für diese Studie kamen von der Tobias-Stiftung, dem Schwedischen Forschungsrat, der Schwedischen Stiftung für strategische Forschung (SSF), der Amerikanischen Stiftung für Gehirn- und Verhaltensforschung (NARSAD), des Schwedischen Gehirnfonds, der Knut und Alice Wallenberg-Stiftung, AFA Försäkring und dem Stadtrat Stockholm durch eine ALF-Vereinbarung mit dem Karolinska Institutet.Weitere Informationen sind abrufbar unter: Karolinska Institutet: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=en&d=130(öffnet in neuem Fenster) Neuron: http://www.cell.com/neuron/(öffnet in neuem Fenster) Europäischer Forschungsrat: http://erc.europa.eu(öffnet in neuem Fenster)
Länder
Schweden