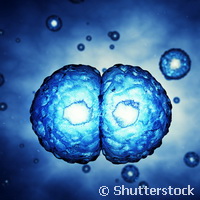Dem Zusammenhang zwischen Zellspeichermechanismus und krankheitsverursachenden Mutationen auf der Spur
Teilt sich eine Mutterzelle in Tochterzellen - was etwa alle 24 Stunden passiert - vererbt die Mutterzelle den Tochterzellen Identität und Funktionen. Ein Forscherteam am schwedischen Karolinska Institutet hat kürzlich mit Hilfe verschiedener Institutionen und EU-finanzierter Projekte die Mechanismen dieser Speicherübertragung entdeckt. Auch wenn es für den Laien nebensächlich scheint, ist die Art und Weise, wie sich unsere Zellen kontinuierlich in zwei identische Kopien teilen, der Schlüssel für unsere eigene Existenz. Ohne die Zellteilung könnten wir nicht wachsen und unsere Wunden würden nicht heilen. Die meisten Arten auf der Erde, und auch der Mensch, würden einfach nicht existieren. Trotz dieser Bedeutung sind einige der zugrundeliegenden Mechanismen der Zellteilung immer noch unbekannt. Das war auch bei der "Zellspeicher"-Übertragung der Fall, einem Prozess, der es den Tochterzellen ermöglicht, von ihren Mutterzellen ihre Funktionen wie z. B. die Insulinproduktion zu erben. Trotz jahrelanger intensiver Forschung konnte kein allgemeiner Mechanismus entdeckt werden, mit dem sich erklären lässt, wie das geschieht. Zugegeben, der Prozess ist schon verblüffend: Transkriptionsfaktoren - d. h. Proteine, die an spezifische DNA-Sequenzen gebunden sind, steuern den Fluss der genetischen Informationen und bestimmen dadurch die Identität und Funktion einer Zelle - werden jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt, gelöscht. Überraschenderweise werden diese Bindungsmuster sowohl bei den Mutter- als auch bei den Tochterzellen wiederhergestellt. Ein unlösbares Geheimnis? "Nun nicht mehr.", sagt Jussi Taipale, Professor im Fachbereich Biowissenschaften und Ernährung (Bionut) am Karolinska Institutet und Leiter des Forschungsteams, dem diese Entdeckung gelungen ist. "Das Problem ist, dass sich in einer Zelle so viel DNA befindet, dass es für die Transkriptionsfaktoren unmöglich wäre, innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens wieder zurückzufinden. Jetzt haben wir einen möglichen Mechanismus für die Funktionsweise dieses Zellspeichers und dafür, wie er der Zelle dabei hilft, sich die vor der Zellteilung herrschende Reihenfolge zu merken, und so die Transkriptionsfaktoren dabei unterstützt, ihren richtigen Platz zu finden, gefunden", erklärt Jussi Taipale. Die Gruppe erstellte die bisher umfassendste Karte der Transkriptionsfaktoren einer Zelle und konnte damit herausfinden, dass ein großer Proteinkomplex namens Kohäsin als ein Ring um die beiden DNA-Stränge, die sich bei der Zellteilung bilden, gelegt wurde, wodurch nahezu alle Plätze auf der DNA gekennzeichnet werden, an denen Transkriptionsfaktoren gebunden sind. Kohäsin umringt den DNA-Strang und die Proteinkomplexe können diesen Ring passieren, ohne ihn zu verschieben. Da die beiden neuen DNA-Stränge im Ring gehalten werden, ist nur ein Kohäsin notwendig, um beide zu kennzeichnen, wodurch die Transkriptionsfaktoren leichter ihren ursprünglichen Bindungsort auf beiden DNA-Strängen finden. "Bevor wir sicher sein können, sind noch weitere Forschungsarbeiten nötig, aber bisher untermauern alle Experimente unser Modell", sagt Martin Enge, Lehrbeauftragter am Bionut am Karolinska Institutet. Transkriptionsfaktoren spielen eine entscheidende Rolle bei vielen Krankheiten, u. a. auch bei Krebs und vielen Erbkrankheiten. In der Zukunft könnte die Entdeckung des Teams daher direkte Auswirkungen für Patienten mit Krebs oder einer Erbkrankheit haben, da Kohäsin als Indikator dafür fungiert, welche DNA-Sequenzen die krankheitsverursachenden Mutationen enthalten könnten. "Gegenwärtig analysieren wir DNA-Sequenzen, die sich direkt in Genen befinden, die etwa drei Prozent des Genoms ausmachen. Die meisten Mutationen, die nachgewiesenermaßen für die Entstehung von Krebs verantwortlich sind, befinden sich jedoch außerhalb von Genen. Wir können diese noch nicht zuverlässig analysieren - das Genom ist einfach zu groß. Nur durch die Analyse von DNA-Sequenzen, die eine Verbindung mit Kohäsin eingehen, etwa ein Prozent des Genoms, könnten wir die Mutationen eines Menschen analysieren und die Durchführung von Studien zur Identifizierung neuer schädlicher Mutationen erleichtern", bemerkt Martin Enge. Das Projekt wurde vom Zentrum für Biowissenschaften am Karolinska Institutet, der Knut and Alice Wallenberg Foundation, dem Schwedischen Forschungsrat, dem Science for Life Laboratory, der Swedish Cancer Foundation, durch die ERC-Finanzhilfe für etablierte Forscher (ERC Advanced Grant) GROWTHCONTROL und das EU-RP7-Projekt SYSCOL unterstützt.Weitere Informationen sind abrufbar unter: Karolinska Institutet http://ki.se/?l=en(öffnet in neuem Fenster) SYSCOL http://syscol-project.eu/(öffnet in neuem Fenster) Projektdatenblatt
Länder
Schweden