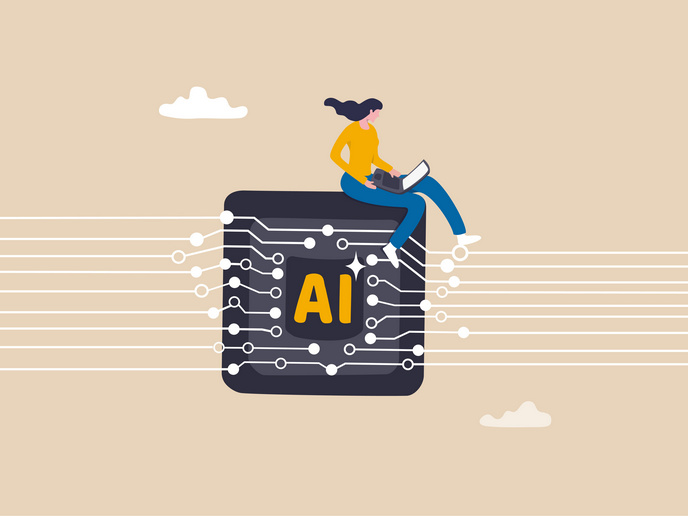Kontaktnetzwerke fördern Eigenständigkeit und Resilienz von Vertriebenen
Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen(öffnet in neuem Fenster) zufolge sind weltweit rund 16 Millionen Menschen gezwungen, jahrelang fern ihrer Heimat zu leben, ohne Aussicht auf Rückkehr, wirkliches Ankommen oder Integration. Diese langfristige Vertreibung (protracted displacement) befördert wirtschaftliche Instabilität, soziale Ausgrenzung sowie Rechts- und Zukunftsunsicherheit. Politische Lösungen lassen die tatsächlichen Bedürfnisse Vertriebener jedoch oft unberücksichtigt und begrenzen eher die Möglichkeiten, statt sie zu erweitern.
Nachhaltige Lösungen im Umgang mit langfristiger Vertreibung
Um die Hintergründe langfristiger Vertreibung besser zu verstehen, führte das EU-finanzierte Projekt TRAFIG(öffnet in neuem Fenster) empirische Untersuchungen in Afrika, Asien und Europa durch. Über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren nahmen mehr als 3 120 Personen daran teil, wobei der Schwerpunkt auf fünf Faktoren lag, die Einfluss darauf haben, ob Menschen in der Situation verbleiben oder ihr entkommen können: Regelungen zu Asylrecht und Flüchtlingsschutz, soziale Absicherung und Lebensgrundlage auf lokaler Ebene, grenzübergreifende Netzwerke und Mobilität, Intergruppenbeziehungen zwischen Vertriebenen und Einheimischen sowie Entwicklungsanreize zur Aufnahme Geflüchteter. „Aus mehr als 2 800 Interviews mit Vertriebenen, politischen Akteuren und Fachleuten ergab sich ein bedenkliches, wiederkehrendes Muster: Bei allen Versuchen, sich nach gewaltsamer Vertreibung ein neues Leben aufzubauen, stoßen Geflüchtete und Binnenvertriebene auf Hindernisse, Barrieren und Sackgassen“, erklärt Benjamin Etzold, wissenschaftlicher Koordinator von TRAFIG und Forschungsleiter am Bonn International Centre for Conflict Studies(öffnet in neuem Fenster), Deutschland. „Hunderte Vertriebener berichteten über Ungewissheit, kein wirkliches Ankommen und endloses Warten auf die unwahrscheinliche Chance, einen klaren Weg aus dem jahrelangen Chaos der Übergangslösungen zu finden.“
Schwerpunkt auf sozialen Kontakten und Mobilität Vertriebener
Die Projektpartner analysierten, inwieweit Regierungspolitik, Asyl- und Schutzprogramme, Hilfsangebote und lokale wirtschaftliche Maßnahmen in Gastländern den äußerst schwierigen Umständen, unter denen Vertriebene oft jahrelang leben, gegensteuern können. Analysiert wurden zudem soziale und wirtschaftliche Vernetzung sowie Mobilität, die über eigene Wohnorte und Gastländer hinausgeht. Wie aus dem Synthesebericht von TRAFIG(öffnet in neuem Fenster) hervorgeht, sind die meisten Geflüchteten oft deutlich besser vernetzt als angenommen. Dabei werden länderübergreifende Netzwerke genutzt, um den Lebensunterhalt zu sichern, Kontakt zu Angehörigen zu halten und Zukunftsaussichten zu verbessern. Abhängig von Land, Wohnort oder Fokusgruppe unterscheiden sich Umfang, Intensität und Verlässlichkeit dieser länderübergreifenden Verbindungen jedoch deutlich. „Insgesamt heißt das, je besser lokale, nationale und transnationale Unterstützungsnetzwerke funktionieren, desto besser können Geflüchtete die vielfältigen Herausforderungen nach der Flucht bewältigen“, sagt Etzold, „und umso leichter fällt ihnen die Neuorientierung, um dieser langwierigen Problematik zu entkommen.“
Unterstützung von Politik und Praxis für bessere Hilfsangebote
Das Leitlinienhandbuch TRAFIG(öffnet in neuem Fenster) enthält Erkenntnisse, Beispiele, Maßnahmenempfehlungen und bewährte Verfahren, d. h. wesentliche Denkanstöße, um menschenzentrierte, tragfähige Lösungen im Umgang mit langfristiger Vertreibung anzubieten. Die Erkenntnisse von TRAFIG tragen dazu bei, die Hauptziele des Globalen Pakts für Flüchtlinge(öffnet in neuem Fenster) des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen zu erreichen, und werden all jenen zugutekommen, die sich für den Schutz Geflüchteter, lokale Integration, Neuansiedlung sowie Rückkehr und zirkuläre Migration einsetzen. Die Forschungsarbeit liefert auch neue Ansätze für humanitäre Hilfsprojekte und Entwicklungspolitik in Erstaufnahmeländern. Ein Instrumentarium für die Praxis(öffnet in neuem Fenster) enthält Vorschläge zur Stärkung von Kontakten im Verlauf der Flucht. „Wir können nun sehr viel besser nachvollziehen, was mit langfristiger Vertreibung verbunden ist und wie soziale Vernetzung Geflüchteten und Binnenvertriebenen hier Beistand leisten kann“, schließt Etzold.