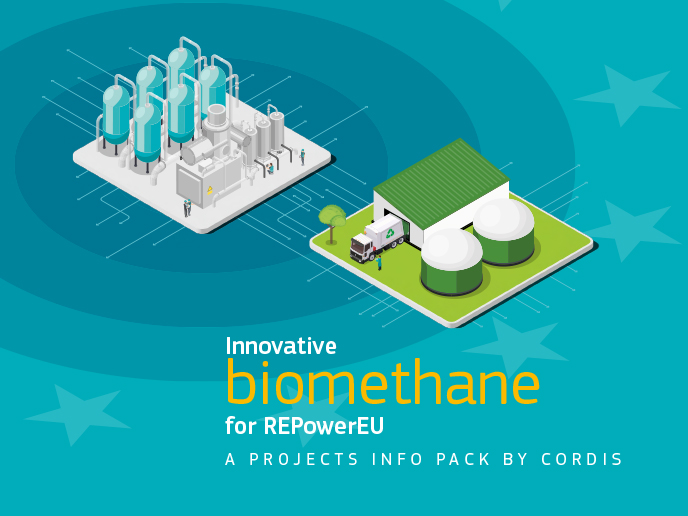Stadtteile mit zurückgewonnener Wärme heizen
Die gegenwärtige Energiekrise lässt das Interesse an Fernwärme(öffnet in neuem Fenster) als wirksames Mittel zur Bereitstellung von CO2-armer Energie neu aufleben. Derartige Netze mit Überschusswärme bei niedrigen Temperaturen zu betreiben, könnte unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zur Beheizung von Wohngebäuden weiter verringern. Wenn in Europa tatsächlich 50 % der Abwärme genutzt würde, könnten 100 % des derzeit für die Beheizung von Gebäuden in Europa verwendeten Erdgases ersetzt werden, wird dem Projekt Heat Roadmap Europe(öffnet in neuem Fenster) zufolge mitgeteilt. Um dieses Ziel zu realisieren, legte das Team des EU-finanzierten Projekts COOL DH(öffnet in neuem Fenster) eine erfolgversprechende breite Palette von Methoden und Werkzeugen vor und demonstrierte deren Wirksamkeit in realen Szenarien. Das Projektteam hat Lösungen für Niedertemperatur-Fernwärme(öffnet in neuem Fenster) in einem gewachsenen Stadtviertel von Høje-Taastrup, Dänemark, und in einem völlig neuen Stadtteil in Lund, Schweden, eingesetzt.
Niedertemperatur-Fernwärme einführen
Im Stadtteil Østerby in Høje-Taastrup, Dänemark, wurde das traditionelle Fernwärmenetz auf den Betrieb bei niedrigen Temperaturen umgestellt. Auf diese Weise konnte innerhalb des Netzes die von einer Wärmepumpe erzeugte Wärme genutzt werden, die an eine Photovoltaikanlage in einem örtlichen Einkaufszentrum angeschlossen war. In einem anderen Stadtbezirk wurde überschüssige (andernfalls an die Umwelt abgegebene) Wärme aus den Kühlmaschinen des Rechenzentrums einer Bank eingesetzt. Auch das Fernwärmenetz wurde runderneuert. „Vor diesem Projekt wurde der Wärmeverlust durch die lokalen Verteilungsrohre im Stadtteil Østerby von den Mietparteien selbst bezahlt“, sagt Reto Michael Hummelshøj, leitender Projektmanager beim Ingenieurbüro COWI(öffnet in neuem Fenster), dem das Projekt koordinierenden Unternehmen. „Das belief sich auf mehr als 35 % der bezahlten Wärmebezugskosten.“ Im Rahmen des Projekts gelang es, die Wärmeverluste auf weniger als 16 % der gelieferten Wärme zu reduzieren, was unter anderem durch eine Senkung der Netztemperatur zustande kam. Das System versorgt insgesamt 159 Wohneinheiten, und die projektinternen Demonstrationen in Høje Taastrup sparen insgesamt über 600 Tonnen CO2 jährlich ein. Im neuen Stadtteil Brunnshög in Lund (Schweden) ist die Hauptquelle der Niedertemperatur-Abwärme ein Teilchenbeschleuniger in der Forschungsanlage MAX IV(öffnet in neuem Fenster). Diese Wärme wird dem Viertel über ein Netz zur Verfügung gestellt, das sich zur größten Niedertemperatur-Fernwärme-Anlage Europas entwickeln soll, wobei auch andere erneuerbare Energiequellen genutzt werden.
Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit
Eine der wichtigsten Projektinnovationen war die Entwicklung eines neuen Typs von PE-RT-Rohren, bei denen schweißbares Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit zum Einsatz kommt. Zu den Vorteilen dieser Rohre zählen eine einfachere Verlegung (da sie buchstäblich ausgerollt werden können), ein Leckageerkennungssystem, eine bessere Dämmung und der Betrieb bei höherem Druck von bis zu 13 bar in Niedertemperatur-Fernwärmenetzen, was weniger Wärmeverlust zur Folge hat. An beiden Demonstrationsstandorten wurden mehrere Kilometer PE-RT-Rohre verlegt. Mit den Rohren eröffnet sich auch die Möglichkeit, das Heizwendelschweißen anzuwenden. Wird dieses Verfahren genormt und für den Einsatz in Niedertemperatur-Fernwärmenetzen zugelassen, könnte es dazu beitragen, einen großen Engpass zu beseitigen, wie Hummelshøj erklärt: „Es mangelt an geprüftem Stahlschweißpersonal. Bei der Arbeit mit Elektroschweißformstücken könnten normale Arbeitskräfte die Rohre nach einer nur wenige Tage dauernden Fortbildung verbinden.“
Einsparungspotenzial auf der Versorgungsseite
Seit Abschluss des Projekts hat ein Industriemitglied des Gemeinschaftsunternehmens das neue PE-RT-Rohr auf den Markt gebracht. „Auf der Grundlage seiner Erfahrungen im Lauf des Projekts konnte ein Hersteller neue Rohrtypen als Teil seiner Produktpalette unter der Marke LOGSTOR PertFlextra(öffnet in neuem Fenster) einführen“, fügt Hummelshøj hinzu. „Es gibt mehrere laufende Projekte, bei denen diese Kunststoffrohre zur Versorgung von Gebieten mit moderner Niedertemperatur-Fernwärme eingesetzt werden sollen.“ Hummelshøj stellt fest, dass auch mehrere andere Herstellungsfirmen neue vorgedämmte Mehrschicht-Kunststoffrohre auf den Markt bringen. Zudem sind neue Formstücke in Vorbereitung. Auf gutem Wege sind zum Beispiel Elektroschweißmuffen, wie sie in Trinkwasserleitungen zum Einsatz kommen. „Die wichtigste Erkenntnis lautet, dass die Rohrverteilungssysteme bei den Renovierungsmaßnahmen auf gar keinen Fall vernachlässigt werden sollten“, so Hummelshøj. „Bei zu vielen Renovierungsprojekten stehen Verbesserungen der Gebäudehülle im Mittelpunkt und dabei werden die großen Einsparpotenziale auf der Seite der Wärmeverteilung vergessen. Diese wurden während des gesamten COOL DH-Projekts deutlich hervorgehoben.“ Eine weitere bei der Projektarbeit gewonnene Erkenntnis ist, dass es schwierig sein kann, in Wohnungsgenossenschaften gemeinsame Entscheidungen zu treffen. „Die Folgen für jede einzelne Mietpartei müssen berechnet und die Vorteile klar dargelegt werden, um bei der Abstimmung über die Umstellung des Heizungssystems eine Mehrheit zu erreichen“, bekräftigt Hummelshøj abschließend.