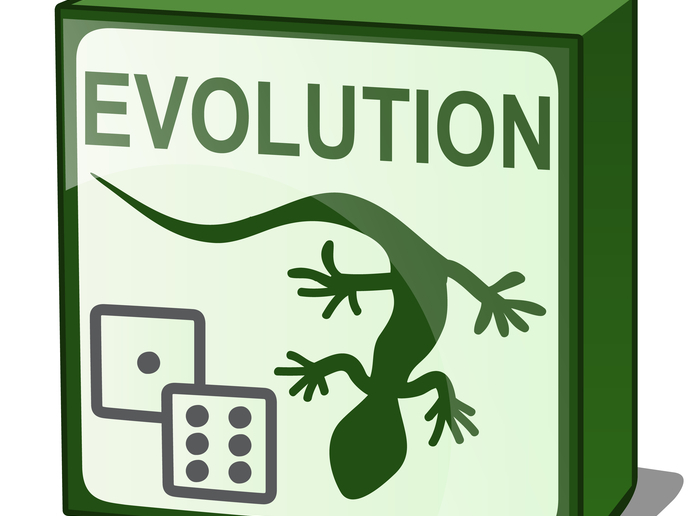Erkenntnisse zur menschlichen Migration durch prähistorische Krankheiten
Neue Verfahren der Genanalyse gestatten einen genaueren Blick auf die Auswirkungen von Krankheiten auf die Migrationsmuster in Ost- und Mitteleuropa über einen Zeitraum von etwa 3 000 Jahren, in der späten Steinzeit und frühen Bronzezeit. Die Veränderungen wurden auf die Suche nach neuen Nahrungsquellen, klimatische und wirtschaftliche Änderungen, massives Bevölkerungswachstum, soziale Umwälzungen und neue Infektionskrankheiten zurückgeführt. „Krankheiten wurden als möglicher Faktor für die Mobilität der Menschen in diesen Umbruchzeiten unterschätzt“, erklärt Projektkoordinator Wolfgang Haak von der Abteilung für Archäogenetik am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie(öffnet in neuem Fenster) in Leipzig. Er weist darauf hin, dass die jüngste COVID-19-Pandemie verdeutlicht habe, welche Störungen Epidemien oder Pandemien hervorrufen können. Im Rahmen des auf fünf Jahre ausgelegten Projekts PALEoRIDER, das vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) finanziert wurde, wurden die genetischen Profile von über 1 000 antiken menschlichen Überresten aus bedeutsamen Regionen in Europa, die tiefgreifende Veränderungen erlebten, sowie ihre Exposition gegenüber Krankheitserregern dokumentiert. Diese Daten wurden mit archäologischen und geschichtlichen Analysen kombiniert. „Durch die Untersuchung der Zähne hatten wir Zugang zu potenziellen Krankheitserregern. Wir können die Krankheiten beleuchten, die sich diese Menschen möglicherweise zugezogen haben“, sagt Haak. Diese Arbeit ist vergleichbar mit den Forschungsbemühungen zur Genomik alter Pathogene im Rahmen des Projekts APGREID.
Genomdaten mithilfe von DNS-Erfassungsmethoden erheben
Es wurde eine große Datenbank mit vergleichbaren angereicherten Genomdaten von Menschen und Krankheitserregern aus wichtigen archäologischen Stätten eingerichtet. Neue DNS-Erfassungsmethoden waren von zentraler Bedeutung für die Analyse archäologischer Überreste. „Die menschliche DNS ist zerfallen und fragmentiert und wird von anderer Umwelt-DNS überlagert, z. B. von Böden, Pilzen und anderen Mikroben, wodurch der Anteil an tatsächlicher menschlicher DNS sehr gering ist – oft nur etwa 1 %“, fügt Haak hinzu. „Bei Bindungstests wird die humanspezifische DNS herausgefischt, und zwar die Varianten im gesamten menschlichen Genom, von denen wir wissen, dass sie vorhanden sind“, erklärt Haak. „Mit Bindungstests werden gezielt hochwertige Daten erzeugt, womit die 1 bis 10 % menschlicher DNS in einer alten Probe auf über 50 % erhöht werden können.“ Die Menge an Erreger-DNS in einem Zahn ist sogar noch geringer, wodurch Bindungsverfahren besonders nützlich sind, um eine Genomsequenz zu rekonstruieren. Die Forschenden können dann beurteilen, ob die Spur eines Krankheitserregers modern ist oder DNS-Schäden aufweist, die darauf hindeuten, dass sie alt ist. Gleichzeitig können sie den Hintergrund der genetischen Abstammung der Menschen prüfen, um falsch-positive Ergebnisse auszuschließen.
Frühe Nachweise von Krankheiten
Er stellt fest: „Wir konnten frühere Nachweise für eine Reihe von Krankheitserregern bestätigen, insbesondere frühe Formen von Yersinia pestis (Y. pestis), also der Pest, während der frühen Bronzezeit sowie Salmonella enterica und prähistorische Viren wie Hepatitis B“. Die unerwartet große Anzahl von Krankheitserregern, die im Laufe der Zeit entdeckt wurden, deutet darauf hin, dass Infektionskrankheiten wie Y. pestis mehr als 3 000 Jahre vor den frühesten Ausbrüchen auftraten, die in schriftlichen Quellen belegt sind, und bietet eine alternative Erklärung für groß angelegte Migrationsbewegungen.
Mehr Interaktion als bisher angenommen
„Vor etwa 5 000 Jahren kam es mit der Ausbreitung von Hirtengesellschaften aus den östlichen Steppen in weiten Teilen Westeurasiens zu einer genetischen Verschiebung. Zu dieser Zeit traten erstmals eine frühe Form von Y. pestis und viele Fälle von Personen auf, die nicht in Massengräbern, sondern normal begraben waren und bei denen die Pest nachweisbar war.“ „Es gibt nicht nur einen Stamm, sondern viele. In dieser ‚globalisierten‘ Welt der Bronzezeit waren Kontakte, Mobilität, Austausch und Wissenstransfer vorhanden, was sich in der Geschichte der Interaktionen zwischen Mensch und Krankheitserreger widerspiegelt“, fügt Haak an. „Die großen, noch ungelösten Fragen sind die Ursprünge und die Art der Übertragung – ob sie sich durch die Migration früher Hirtenvölker ausbreiteten, oder ob sie generell auf den neuen pastoralen Lebensstil zurückzuführen sind, der eine engere Interaktion mit Tieren mit sich brachte, wodurch Krankheiten von einer Art zur nächsten übersprangen.“