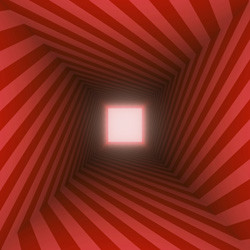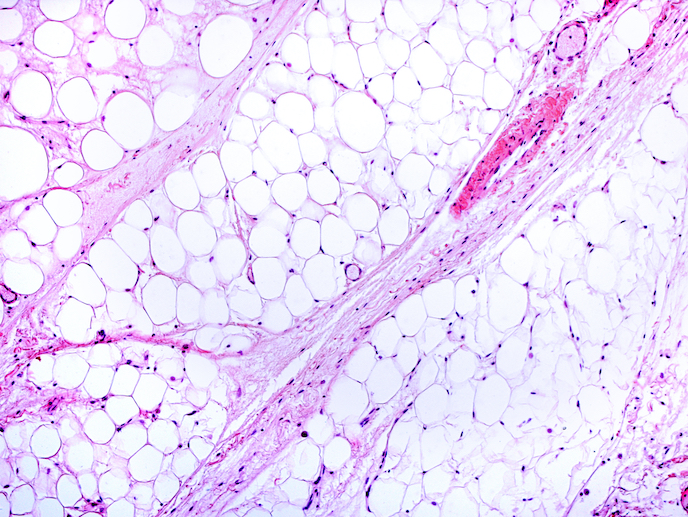Kortikale Mechanismen der Tiefenwahrnehmung
Um einen Gegenstand gezielt ergreifen zu können, muss das Gehirn den Betrachtungsabstand ermitteln und damit Form und Tiefe des Objekts erkennen. Wie das Gehirn diesen Betrachtungsabstand in ein körperzentriertes Referenzsystem eingliedert und so die Objekttiefe ermittelt, ist allerdings ungeklärt. Binokulare Disparität, d.h. der geringe Unterschied zwischen den beiden Bildern, die die Augen wahrnehmen, ist eine Voraussetzung für die Erkennung von Tiefe. Eine der Theorien über Tiefenwahrnehmung geht davon aus, dass die für das Tiefensehen nötige Disparität nicht in der Netzhaut, sondern kortikal entsteht. Das EU-finanzierte Projekt "Interaction of relative and absolute depth signals in the primate brain" (REAL-DEPTH) sollte die Rolle und Mechanismen von Konvergenzsignalen (Konvergenz oder Divergenz der sich fixierenden Augen) bei der Tiefenwahrnehmung am Menschen und Affen untersuchen. Affen und Menschen wurden gleiche Aufgaben vorgelegt. Dabei wurde mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) die Gehirnaktivität gemessen. fMRT stellt Veränderungen der Durchblutung im Gehirn dar und leitet daraus Veränderungen der Zellaktivität ab, da mehr Sauerstoff und Nährstoffe im Blut transportiert werden. mit fMRT können farbige Karten der Gehirndurchblutung erzeugt werden, die dann mit einer hochmodernen neuen Bildverarbeitungstechnik (Multi-Voxel-Musteranalyse) ausgewertet werden. Das erste Experiment untersuchte die Modulation der kortikalen Aktivität in Abhängigkeit von der Vergenz. Beim Menschen beginnt die Modulation offenbar bereits (in der Sehbahn), wenn das Objekt im primären Sehfeld wahrgenommen wird, was die erste Stufe der kortikalen Verarbeitung darstellt. Die Ergebnisse wurden auf zwei internationalen Konferenzen vorgestellt und für einen Fachbeitrag vorbereitet. Im zweiten Experiment sollten kortikale Bereiche identifiziert werden, die die Position des Objekts auf den Körper statt auf die Netzhaut beziehen. Erste Aufnahmen beim Menschen legten nahe, dass bestimmte Teile des Gesichtsfelds, insbesondere der Bereich direkt vor den Augen, im fMRT mit erhöhter Aktivität im visuellen Cortex einhergehen. Versuche mit Affen erbrachten in beiden Paradigmen ähnliche Ergebnisse wie bei Menschen. Um bessere Aufnahmen zu machen, will das Team in den Experimenten künftig eine neue fMRT-Spule einsetzen, die im Rahmen des Projektes speziell für Affen entwickelt worden war. Bestätigen sich die bei den Menschen gemachten Ergebnisse bei nicht-menschlichen Primaten, könnten wichtige Rückschlüsse auf die visuelle Verarbeitung gezogen und möglicherweise sogar aktuelle Modelle überdacht werden.