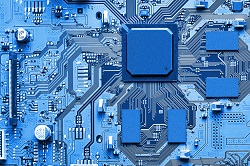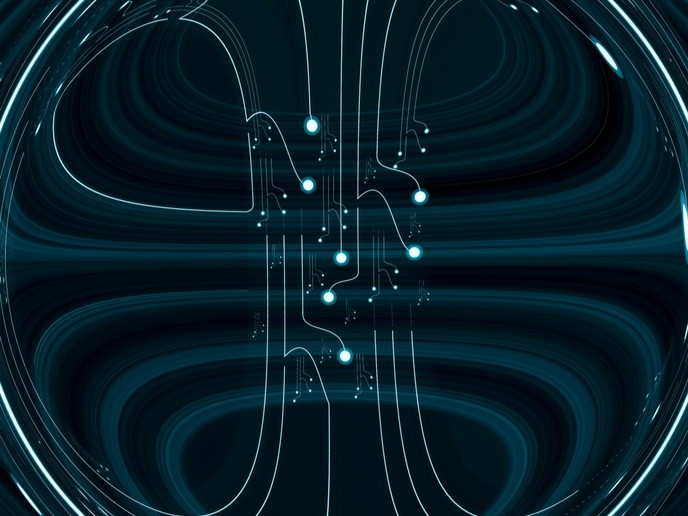Den besseren Schaltkreis entwerfen
Welche Gemeinsamkeit haben Smartphones, Laptops, medizinische Diagnoseausrüstung und die Steuerteile unserer Autos? Sie alle basieren auf Halbleitern und verkörpern das Neueste an innovativen Entwurfs- und Fertigungsprozessen. Im Einzelnen werden die meisten dieser Dinge aus neuen Materialien und Strukturen in Nanometergröße hergestellt. Trotz der vielen Vorteile, die derartige kleinformatige Strukturen haben, sind sie gleichermaßen anfällig für zahlreiche Probleme wie etwa die Überhitzung der integrierten Schaltungen und Signalstörungen. Das EU-finanzierte NANOCOPS-Projekt verfolgte das Ziel, diese Probleme zu unterbinden, bevor sie auch nur die leiseste Chance haben, sich auf Ihrem neuen Gerät zu manifestieren. Zu diesem Zweck entwickelte man im Rahmen des Projekts Algorithmen und Softwareinstrumente, die in der Lage sind, diese unerwünschten Effekte zu quantifizieren und zuverlässige Validierungen neuer nanoelektronischer Entwürfe bereitzustellen. Instrumentarium für Simulationen Eines der Kernziele des Projekts war die Erschaffung eines sinnvollen und leistungsfähigen Schaltungsdesigns, das immer mehr Bauelemente auf einer immer kleineren Trägerfläche aufnehmen kann, so dass mehr Informationen störungsfrei übertragen werden können. „Das zugrundeliegende Problem besteht darin, dass die physikalischen Grenzen der Trägeroberfläche ausgereizt sind, da wir einzelne Schaltungen und Komponenten immer näher zusammendrängen, was zur zunehmenden Gefahr sogenannter Überschneidungseffekte (Crosstalk) führt, die unerwünschte elektromagnetische Wechselwirkungen zwischen einzelnen Komponenten bewirken“, erläutert Projektforscher Dr. E. Jan W. ter Maten. „Dieses Problem kann nicht länger ignoriert werden, zumal wir weiterhin immer leistungsstärkere Chips entwickeln.“ Die im Rahmen des NANOCOPS-Projekts entwickelte Reihe von Instrumenten wurde speziell zum Austesten dieser physikalischen Grenzen gebaut. So wurden zum Beispiel Modelle und Simulationen erstellt, um zu ermitteln, wie weit eine Fläche bei gleichzeitiger Steigerung der Komponentenanzahl verkleinert werden kann, bevor unerwünschte Wechselwirkungen auftreten. Eine weitere Forschungsrichtung wendete eine direkt in die Chipsimulation integrierte Kombination aus elektromagnetischem Feld und thermischen Simulationen an, die es den Forschern gestattet, während der Entwicklungsphase hochempfindliche, störanfällige Schaltungskomponenten zu identifizieren. „Wir mussten feststellen, dass Probleme dann auftreten, wenn elektrische und thermische Wechselwirkungen die Komponente beeinflussen, was Auswirkungen auf die Materialspannung und die Lebensdauer der Transistoren hat“, sagt ter Maten. „Daher ist eine korrekte Bewertung der Wärmeentwicklung wichtig, um leistungsfähigere und strapazierfähigere Transistoren entwickeln zu können.“ Zuverlässigere Vorhersagen für bessere Entwürfe Das NANOCOPS-Projekt resultierte in etlichen bahnbrechenden Entwicklungen im Zusammenhang mit nanoelektronischem Design. Zum Beispiel waren herkömmlicherweise zwei getrennte Operationen erforderlich, um die Abhängigkeit zwischen hohen Temperaturen und extremen Leistungsniveaus in Schaltkreisen zu simulieren. Die NANOCOPS-Forscher konnten jedoch erstmals diese beiden Schritte mit Erfolg kombinieren, womit die Simulation beschleunigt und maßgeblich verbesserte Resultate erzielt werden. Auf dem Gebiet der Simulation des elektromagnetischen Felds kann das NANOCOPS-Instrument nicht nur einzelne Komponenten in 3D simulieren, sondern auch die Schaltkreise an sich, so dass sämtliche Störungsarten simuliert werden können und eine viel schnellere Fehlererkennung möglich wird. Die Minimierung von Signalstörungen bei Smartphones und Herzschrittmachern erfordert beispielsweise die wirkungsvolle Simulation verschiedener Hochfrequenzsignale auf sehr unterschiedlichen Frequenzen. Hier interagieren elektronische Schaltkreise, elektromagnetische Felder und Wärmeentwicklung, und diese Faktoren sowie die Alterung der Bauelemente selbst bewirken Veränderungen, die bislang nicht prognostiziert werden konnten. „NANOCOPS und die verschiedenen im Rahmen des Projekts entwickelten Simulationswerkzeuge haben das alles verändert“, fasst ter Maten zusammen. „Die Hersteller können nun den Entwurf ihrer integrierten Schaltungen auf zuverlässige Vorhersagen gründen und auf diese Weise deren Funktionsfähigkeit, Effizienz und Lebensdauer verbessern.“