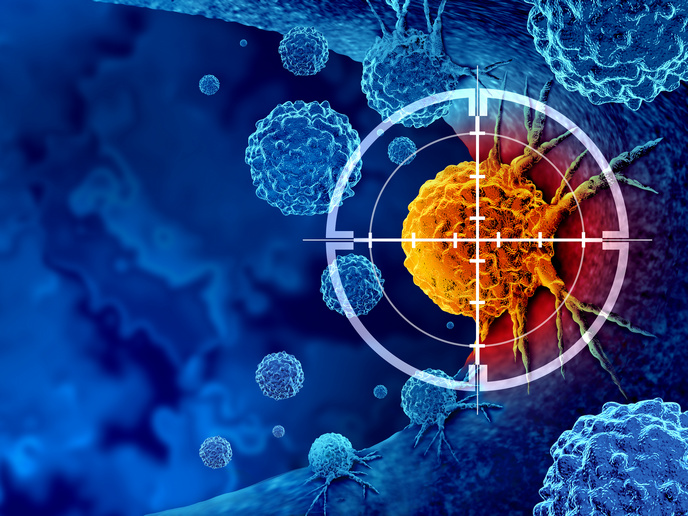Die tatsächlichen Wirkungen von Nanopartikeln in ihrer Umgebung
Bei Meerwasser stellt sich eine besondere Situation dar, da es Ionen und organische Stoffe enthält, die mit Nanopartikeln (NP) in Wechselwirkung treten und ihren Wirkmechanismus beeinflussen können. Mithilfe eines innovativen in-vivo-Expositionssystems für natürliche Gewässer untersuchten die Forscher die Wirkungen von Metalloxid-NP. Für die Forschungsarbeit von SOS-Nano wurden Larven der Japanischen Auster (Crassostrea gigas) verwendet. Die Projektkoordinatorin Professorin Tamara Galloway erklärt, warum man sich für C. gigas entschied: „Da Austernlarven ihre Nahrung bereits in einem sehr frühen Entwicklungsstadium aus dem Wasser filtern, eignen sie sich zur Modellierung der Bioverfügbarkeit (Aufnahme in den Organismus) und der Wirkungen der Partikel, wie zum Beispiel ihre Fähigkeit, oxidativen Stress auszulösen oder die Entwicklung zu beeinflussen.“ Zwei Modelle zur Bestimmung der ökotoxischen Wirkungen im Vergleich Es wurden zwei beispielhafte Struktur-Wirkungsbeziehungen untersucht: Das erste Paradigma betraf die Messung der Dissolution und Bandlückenenergien als Prädiktoren von oxidativem Stress. Das zweite beurteilte die Bildung von oxidativem Stress als toxikologischem Pathway zur Vorhersage von gesundheitlichen Schäden. Das Team testete darüber hinaus die im Meerwasser vorhandenen Ionen, organischen Substanzen und Proteine, um herauszufinden, ob die Auswirkungen von NP dadurch abgeschwächt wurden. Die Projektergebnisse haben bestätigt, dass – neben den physikochemischen Eigenschaften, die ihren Wirkmechanismus bedingen – weitere NP-Eigenschaften berücksichtigt werden müssen, um die Toxizität im Meerwasser vorherzusagen. Daten zu Verhalten, Verbleib und Auswirkungen von NP in realistischen Szenarios In einer umfassenden Projektdatenbank wurden Informationen zu den primären physikochemischen Eigenschaften der Modell-NP sowie zu ihren sekundären Eigenschaften und der Oxidationsaktivität in Meerwasser erfasst. Mithilfe von hochauflösenden Bildgebungsverfahren verfolgten die Forscher die Ingestion und Internalisierung der NP in den Larven. Durch Dissolutionstests und eine abiotische Messung der Redoxaktivität wurde zudem der tatsächliche Wirkmechanismus von NP beurteilt. Dabei wurden im Hinblick auf die angestrebten Wirkmechanismen – Dissolution und Bandlücke – stellvertretend zwei NP untersucht: Zinkoxid (ZnO) und Mangandioxid (MnO2). Bei den Austernlarven trat durch ZnO schwere Toxizität auf, da das Meerwasser keine hemmende Wirkung auf die Dissolution hatte. Dieser Wirkmechanismus lässt sich aber interessanterweise durch organische Stoffe abschwächen. MnO2-NP hingegen sind an der Oberfläche redoxaktiv und zeigten daher bei allen Expositionsszenarien keine Toxizität. “Unsere Experimente haben verdeutlicht, dass der Salzgehalt das toxikologische Verhalten redoxabhängiger Wirkmechanismen in der Meeresumwelt durch die Sorption von Ionen an reaktiven Plätzen entscheidend mitbeeinflussen kann“, so Prof. Galloway dazu. Erweiterung der Test-Ionen Im Rahmen ihres zweijährigen Projekts haben die Forscher von SOS-Nano eine umfassende Reihe komplexer Experimente durchgeführt, für die ein breites Spektrum innovativer Technologien zum Einsatz kam. „Dafür war ein akribisch erarbeiteter Zeitplan nötig, um den Projektzeitrahmen einzuhalten – eine große Herausforderung“, betont Prof. Galloway. Die Projektergebnisse belegen, dass die Modellvalidierung der Toxizität von zwei verschiedenen Metalloxid-NP bei Austernlarven – einem Organismus mit ausgesprochen hoher Empfindlichkeit gegenüber den Wirkungen von NP – eine solide Forschungsgrundlage darstellt. Künftige Tests könnten darauf aufbauen und den Umfang der untersuchten Nanomaterialien auf weitere Arten erweitern, die den gleichen Wirkmechanismus aufweisen, sich aber in ihrer Fähigkeit, mit Komponenten im Meerwasser in Wechselwirkung zu treten, unterscheiden. Aus den Beobachtungen zur Internalisierung in den Larven lässt sich außerdem schließen, dass Veränderungen der physikochemischen Eigenschaften von NP auf ihrem Weg von marinen in biologische Umgebungen, und wieder zurück, ebenfalls wertvolle Informationen zur NP-Toxizität liefern könnten. Die größte Hürde für das sichere Wachstum dieses Wirtschaftssektors, der zu den sechs von der EU-Kommission benannten Schlüsseltechnologien der EU zählt, besteht damit nun noch darin, dass bislang keine zuverlässige Bewertung der Risiken von NP für Mensch und Umwelt vorliegt. In dieser Hinsicht konnte das SOS-Nano-Projekt einen der bahnbrechendsten Aspekte der Nanoökotoxikologie beleuchten. „Wenn erst einmal die Mechanismen hinter dem Oxidationspotenzial von NP abgeklärt sind, könnte dies ganz neue Paradigmen oder auch die Anpassung bestehender Modelle ermöglichen“, prognostiziert Prof. Galloway.