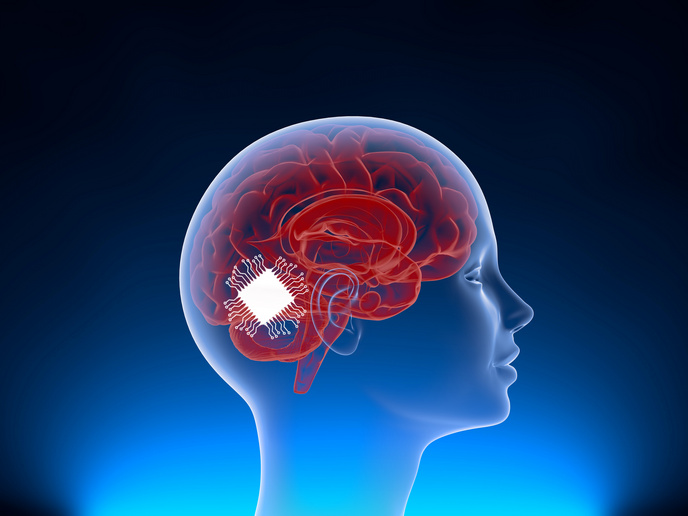Von Mäusen und Stress
Die Wechselwirkung zwischen Stress und Ernährung kann sich manchmal als überaus toxisch erweisen. „Stress kann direkte Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme haben, und dazu führen, dass Menschen exzessiv fetthaltige und zuckerhaltige Lebensmittel zu sich nehmen“, erklärt Frank Meye(öffnet in neuem Fenster), Forscher am UMC Utrecht(öffnet in neuem Fenster). Aber was genau bewirkt Stress im Gehirn, der diese Essstörungen auslöst? Mit Unterstützung des EU-finanzierten Projekts ReCoDE wollte Meye eine Antwort auf diese Frage finden. Das mit Unterstützung durch den Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) geförderte Projekt untersuchte anhand von Mausmodellen, welche Gehirnschaltkreise mit Stressessen in Zusammenhang stehen.
Das Gehirn und seine Rolle bei der Nahrungsaufnahme
Das Projekt konzentrierte sich auf eine Region im vorderen Bereich des Gehirns, den sogenannten präfrontalen Cortex (PFC), der bekanntermaßen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung, Impulskontrolle und Formulierung von Verhaltensstrategien spielt. „Es handelt sich außerdem um eine sehr stressempfindliche Region, die mit Essstörungen und Fettleibigkeit in Verbindung gebracht wird“, fügt Meye hinzu. Die Forschenden betrachteten zudem eine weitere Hirnregion, die als lateraler Hypothalamus (LHA) bezeichnet wird. Laut Meye spielt diese Region eine große Rolle bei der Nahrungsaufnahme. „Im LHA befinden sich Neuronen, die aktiv an der Steuerung unseres Appetits auf schmackhafte Speisen beteiligt sind, und auch Neuronen, die an der Reduzierung unseres Appetits beteiligt sind“, erklärt Meye. Die Neuronen im LHA erhalten außerdem ein starkes Eingangssignal von Neuronen im PFC. „In Anbetracht dieser Erkenntnis wollten wir unsere Hypothese prüfen, dass Stress die Kommunikation zwischen PFC und LHA so verändern würde, dass die Neuronen des LHA, die das Verlangen nach Nahrung befeuern, aktiver, und die Neuronen des LHA, die das Verlangen nach Nahrung bremsen, weniger aktiv werden, bis hin zu einem gesteigerten Appetit und sogar zu Essanfällen“, bemerkt Meye.
Stressessen beginnt erst im Nachhinein
Die Forschenden stellten fest, dass bei einer Maus in einer Stresssituation die PFC-Neuronen, die zum LHA projizieren, sofort reagieren. Besonders interessant war jedoch die Beobachtung der Forschenden einen Tag nach dem Stressereignis. Zum einen stellten sie eine Stärkung der Kommunikation zwischen PFC-Neuronen und verschiedenen LHA-Zellen fest, welche bei Aktivität zu erhöhter Nahrungsaufnahme führen. Zum anderen sahen sie, dass das Stressereignis die Kommunikation zwischen PFC-Neuronen und den LHA-Zellen, die für die Verringerung der Nahrungsaufnahme verantwortlich sind, schwächte. Die Forschenden fanden außerdem heraus, dass diese anhaltenden Plastizitätsveränderungen im PFC-LHA-Netzwerk mit einem gesteigerten Appetit und erhöhtem exzessiven Fressverhalten der Mäuse einhergingen. „Dass sich dies einen Tag nach dem Stressereignis ereignete, ist eine wichtige Erkenntnis, die verdeutlicht, dass man nicht unbedingt am Stresshöhepunkt ans Essen denkt, sondern erst einige Zeit später“, bemerkt Meye.
Die Tür zu neuen Behandlungsmethoden für Essstörungen öffnen
Ein weiteres wichtiges Ergebnis war die Erkenntnis, dass die Rolle des PFC bei der Nahrungsaufnahme nur im Stresskontext zum Vorschein kommt. „Als wir den PFC-LHA-Signalweg bei gestressten Mäusen hemmten, geschah etwas Interessantes – sie nahmen eine normale Menge an Nahrung sich, so als wären sie überhaupt nicht gestresst“, sagt Meye. Bahnbrechende Entdeckungen wie diese könnten den Weg zu neuen Behandlungsmethoden für Essstörungen und Fettleibigkeit ebnen. „Das Verständnis der Neurobiologie, die den Auswirkungen von Stress auf das Essverhalten zugrunde liegt, könnte auf lange Sicht Ansatzpunkte für biologisch fundierte Interventionsstrategien zur Behandlung solcher Störungen liefern“, lautet das Fazit von Meye.