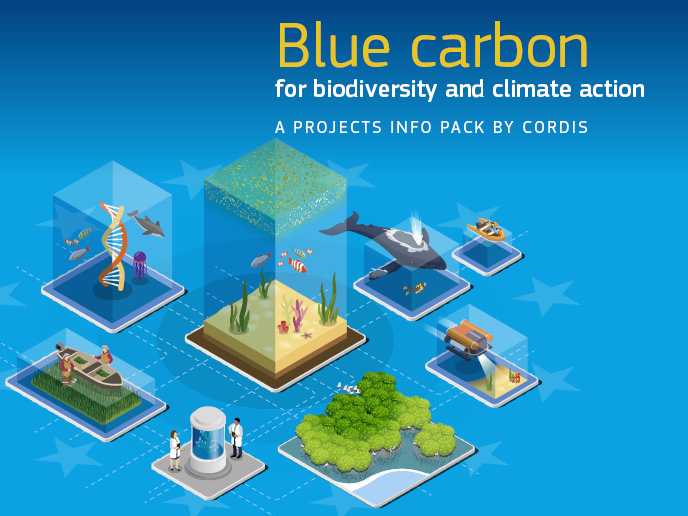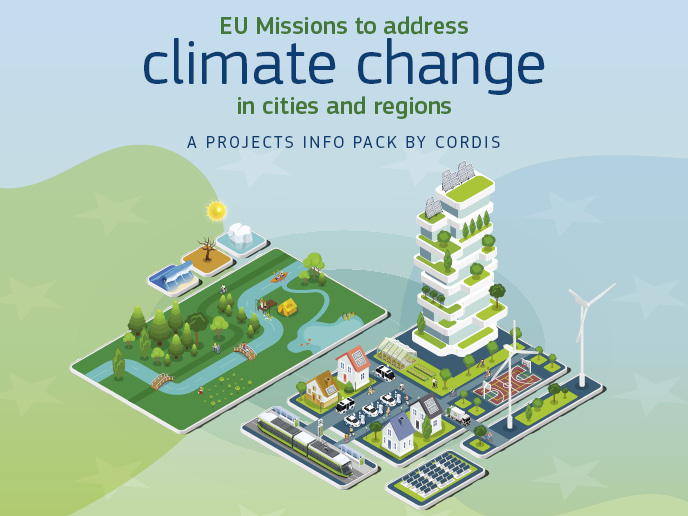Anpassung im Schatten des Menschen
Das Projekt ADAPT-ENVGENOME(öffnet in neuem Fenster) (Environmental adaptation of the genome: A Daphnia model under cultural eutrophication) befasste sich mit genetischen Veränderungen beim Wasserfloh Daphnia. Diese interdisziplinäre Studie integrierte Methoden aus den Bereichen Genetik, Physiologie und Wiederbelebungsökologie und koppelte sie mit Experimenten zu Wettbewerb und jugendlichen Wachstumsraten. Die Forscher untersuchten die Ökosysteme in fünf Seen in Minnesota (USA) mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen der Eutrophierung (vom Menschen verursachte Nährstoffanreicherung). Parallel dazu sammelten die Forscher Genom-Daten in Verbindung mit genetischen Pfaden, die an der Verarbeitung des wichtigen Elements Phosphor (P) bei Wasserflöhen aus verschiedenen Zeitperioden beteiligt sind. Dazu untersuchten sie Proben aus dem Sediment von Laichstellen in diesen Seen mithilfe von Methoden der Wiederbelebungsökologie. Daraus ergab sich eine Fülle von Daten über den Nährstoffgehalt in der Umgebung des heutigen Wasserflohs und seiner Verwandten in den vergangenen Jahrhunderten. Die Daten zeigten, dass konkurrierende Daphnia-Genotypen (Klone) aus dem See mit variierendem Eutrophierungsgrad Wettbewerbsvorteile bei hohem und niedrigem Phosphorgehalt aufwiesen. Darüber hinaus kann diese Population aus dem variablen See Phosphor besser halten. Allerdings verfügten Jungtiere, die sich nicht gut gegen Daphnia-Klone aus einem See mit nahezu konstanter Phosphorzufuhr behaupten können, über eine größere Plastizität in ihrer Wachstumsrate. Die meisten wiesen eine höhere Wachstumsrate in den frühen Phasen ihres Lebenszyklus auf. Diese Ergebnisse wurden Im Rahmen des Evolution Meeting 2013 in Utah, USA, vorgestellt. Mithilfe von Filterverfahren aus Bioinformatik-Pipelines wurden 40.000 mutmaßliche SNP-Marker auf fast 8.500 sehr sichere und bi-allelische Loci im Wasserfloh-Genom reduziert. Etwa 11% konnten eindeutigen Positionen auf dem Referenz-Genom von Daphnia pulex zugeordnet werden. Bei dem beachtlichen Anteil von fast 45% von SNP in einer Analyse fand man eine Beteiligung am Lipid/, Nukleotid- und Aminosäurestoffwechsel und an vier Regulationspfaden. Die Forschungsergebnisse, die in einem dritten zur Veröffentlichung eingereichten Artikel präsentiert werden sollen, zeigen, dass ein Teil der evolutionären Veränderungen mit dem Eutrophierungsgrad in Verbindung stehen könnten. Die endgültigen Ergebnisse sollten Elemente der mikroevolutionären Veränderungen unter Selektionsdruck durch Phosphorverschmutzung aufdecken und Forscher werden mit größerer Wahrscheinlichkeit Gene finden, die an diesen Anpassungen beteiligt sind. Die Erkenntnisse des Projekts könnten einen großen Einfluss auf das Ökosystemmanagement haben, was die Prüfung von Wasserverschmutzung, die Erhaltung und invasive Arten betrifft.