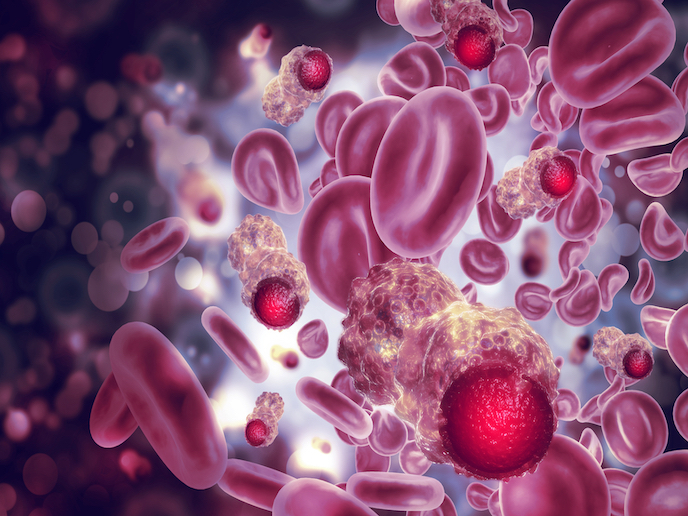Zur Aktivierung von Checkpoints bei der DNA-Schadensantwort
Pol eta, die entscheidend an der DNA-Reparatur mitwirkt, ist eine DNA-Polymerase, mit der Zellen nach DNA-Schäden den Replikationsprozess fortführen können. Mutationen erhöhen das Risiko für Xeroderma pigmentosum und damit Hautkrebs. Das EU-finanzierte Forschungsprojekt TLSCHECK (Regulation of pol-eta by phosphorylation, ubiquitination and sumoylation) untersuchte pol eta und dessen Funktion und Regulation nach Modifizierung durch verschiedene Proteine. Schwerpunkt war dabei die Rolle bei der Zellreparatur und Überwachung von DNA-Schäden. Schwerpunkt dabei war ein neu entdecktes Protein, das die Rekrutierung von pol eta zur Replikationsgabel kontrolliert, wo die DNA-Synthese stattfindet. Damit wird gewährleistet, dass die Polymerase nicht rekrutiert wird, wenn die DNA-Replikation reibungslos verläuft. Eine fehlerhafte Regulierung von Polymerasen kann zudem Mutationen auslösen, was medizinisch von Bedeutung ist. Ein weiterer Kontrollmechanismus für pol eta ist die Phosphorylierung, und neueren Untersuchungen zufolge wird die Polymerase nach DNA-Schäden durch Phosphorylierung aktiviert. Die Forscher identifizierten neue Bereiche, in denen diese Modifikation stattfindet. Die Phosphorylierung ist damit offenbar eine weitere Möglichkeit, pol eta zu kontrollieren und dadurch DNA-Schäden zu vermeiden. Neue Kenntnisse zu den molekularen Mechanismen bei der Regulierung von pol eta enthüllten, wie sie zur Stabilität des Genoms beiträgt. Die neu identifizierten Proteine können die Grundlage neuer diagnostischer Marker für atypische Xeroderma pigmentosum sein. Auf längere Sicht könnte TLSCHECK damit die Entwicklung von Krebstherapien befördern, bei denen Zelltod induziert und synthetische Letalität mit medikamentösen Strategien kombiniert wird.