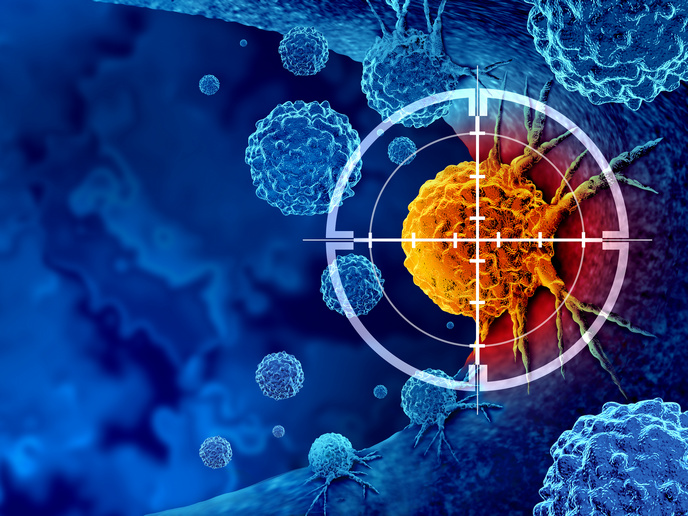Genetische Einflussfaktoren der Staphylokokkeninfektion
Zunehmend deuten Beweise darauf hin, dass der Krankheitserreger während der Infektion mit S. aureus in eine intrazelluläre Infektionsstufe eintritt, die für das Fortschreiten der Erkrankung bedeutsam ist. Diese infizierten Phagozyten dienen als Reservoirs disseminierter Infektion und deuten auf die Schaffung einer vorteilhaften Intraphagocytenumgebung hin. Der Mechanismus des S. aureus-Phagozytenparasitismus ist gegenwärtig jedoch unbekannt. Wissenschaftler des von der EU finanzierten Projekts STAPHYLOMICS (Identifying host factors involved in staphylococcal infection) interessierten sich für die Gene, die innerhalb der Phagozyten in Reaktion auf die S. aureus-Internalisierung ausgelöst wurden. In diesem Zusammenhang nutzten sie ein Zebrafischmodell der S. aureus-Infektion und analysierten die Transkriptionsreaktion des Wirts auf eine In-vivo-S. aureus-Infektion. Zu diesem Zweck führten sie eine RNA-Sequenzanalyse der beiden Haupttypen von Phagozyten – Neutrophilen und Makrophagen – durch, die man aus infizierten Zebrafischlarven aussortierte. Die Resultate wurden im Vergleich zum Aufbau des Zebrafischgenoms kommentiert. Eine statistische Analyse von differentiell exprimierten Genen in infizierten Phagozyten im Vergleich zu deren nichtinfizierten Pendants erbrachte interessante Resultate. Das Team führte nachfolgend Nutzen und Schaden bei Funktionsansätzen auf, um die Rolle dieser Treffer in der Krankheitsentwicklung von S. aureus aufzuklären. Interessanterweise stellte man fest, dass S. aureus die Entzündungssignalisierung des Wirts unterdrückte. Zwei der entzündungsassoziierten Gene waren in das Überleben der Bakterien verwickelt. Zudem reagierten sowohl Neutrophile als auch Makrophagen durch Autophagie auf die Internalisierung von S. aureus, und die Wissenschaftler ermittelten Gene, die in diesem Prozess maßgeblich waren. Gelangt man zu einem besseren Verständnis des Wechselspiels zwischen Staphylokokkenwirt und Krankheitserreger, können alternative therapeutische Strategien abgeleitet werden. Die Erkennung von Wirtsgenen, die an der Bekämpfung des Staphylokokkenwachstums im Lauf der Infektion beteiligt sind, zieht wichtige klinische Konsequenzen nach sich und kann therapeutische Targets für die Entwicklung der nächsten Generation antimikrobieller Arzneimittel erschaffen. Darüber hinaus haben auf den Wirt ausgerichtete Ansätze zur Modulierung des Immunsystems großes Potenzial in der Infektionsbekämpfung. Sie sind von größtmöglicher Dringlichkeit, da zunehmend virulente, gegen Arzneimittel mehrfachresistente Stämme des S. aureus in Erscheinung treten, die erhebliche Morbidität und Mortalität verursachen.