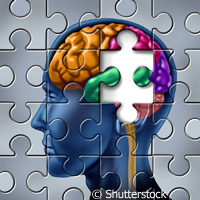Ursachen von ALS aus neuem Blickwinkel
Bei Forschungsergebnissen, die in spektakulärer Weise das Leben von Menschen verändern oder neue Wege in der Medizin eröffnen, geht es meist um Beweise von Hypothesen oder die Aufdeckung von Ursachen. Genauso aufschlussreich ist aber das Widerlegen einer These, denn wenn sie aus der Vielzahl der Möglichkeiten ausgeschlossen wird, kann man sich jahrelange vergebliche Forschungen sparen. Ein deutsches Forscherteam hat genau das gemacht. In ihrem Bericht im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) widerlegen die Forscher einen bislang vermuteten ursächlichen Zusammenhang bei neurodegenerativen Erkrankungen. Die Ergebnisse stammen vorerst von Tiermodellen der humanen amyotrophen Lateralsklerose (ALS, auch Motoneuron-Krankheit), aber aus ihnen lassen sich Rückschlüsse auf andere neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Chorea Huntington ziehen. Finanziert wurde die Studie durch das Projekt iPSoALS (Modeling sporadic ALS in motor neurons by genetic reprogramming of patient skin fibroblasts), das Teil des mit 2 Mio. EUR geförderten ERA-NET-Forschungsförderungsprogramms NEURON des Siebten Rahmenprogramms (RP7) ist. Symptome, die für eine neurodegenerative Erkrankung typisch sind, sind zum einen die Zerstörung von Axonen (zuständig für die Übertragung elektrischer Nervenimpulse in den Zellen), zum anderen der Verlust von Synapsen (als Kontaktstellen zwischen den Neuronen). Zurückgeführt wurden solche Schädigungen bislang auf den fehlerhaften bidirektionalen Transport von Organellen (etwa Mitochondrien als zellinternen Kraftwerken) entlang der Axone von Nervenzellen. Dies wurde nun jedoch von einem Forscherteam der Technischen Universität München (TUM) und der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) in Frage gestellt, das im Rahmen der bislang größten Studie ihrer Art dieser These nachging. Es untersuchte mit neuartigen Bildgebungsverfahren in hochauflösender räumlicher und zeitlicher Darstellung an verschiedenen ALS-Tiermodellen Veränderungen sowohl in der Axonenmorphologie als auch im Organellentransport. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Transportstörungen und Axonendegeneration unabhängig voneinander entwickeln, und setzen damit die Theorie außer Kraft, dass eins das andere bedingt. In Echtzeit wurde der axonale Organellentransport in lebendem Gewebe beobachtet. Dabei wurde der Weg einzelner Mitochondrien mithilfe eines neuen Bildgebungsverfahrens, das mit der Markierung von Zellen in transgenen Tieren arbeitet, detailliert nachverfolgt. Desgleichen gelang es den Forschern, den Transport anderer Organellen bzw. Vesikeln - den Endosomen - zu beobachten. Sie untersuchten hierzu verschiedene ALS-Tiermodelle menschlicher Mutationen, die mit der Krankheit assoziiert werden. Professor Thomas Misgeld, einer der Studienautoren vom Institut für Neurowissenschaften der Technischen Universität München, erläutert die Ergebnisse: "Wir gehen davon aus, dass diese Erkenntnisse sich auch auf andere ALS-Studien anwenden lassen, vielleicht sogar auf andere neurodegenerative Erkrankungen. Unser Experiment zeigte deutlich, dass es nicht so einfach ist, getreue Modelle von neurodegenerativen Erkrankungen zu erstellen. Es könnte sich also lohnen, in bessere Tiermodelle zu investieren, da dies die einzige Möglichkeit ist, mechanistische Studien durchzuführen und diese kontinuierlich mit der menschlichen Pathologie oder humanen Zellmodellen abzugleichen. Dabei kann man durchaus parallel mit einigen alten Modellen weiterarbeiten. Allgemein liefern unsere Untersuchungen auch Einblicke in die biologischen Zusammenhänge zwischen axonalen Transportstörungen und degenerativen Veränderungen - die bei weitem nicht so offensichtlich sind wie scheint. Hier gilt es noch viel zu erforschen." iPSoALS bringt Forscher aus Frankreich, Deutschland, Israel und Schweden mit dem Ziel zusammen, den Ursachen von ALS genauer auf den Grund zu gehen.Weitere Informationen finden Sie unter: Technische Universität München (TUM): http://portal.mytum.de/welcome/(öffnet in neuem Fenster)
Länder
Deutschland, Frankreich, Israel, Schweden