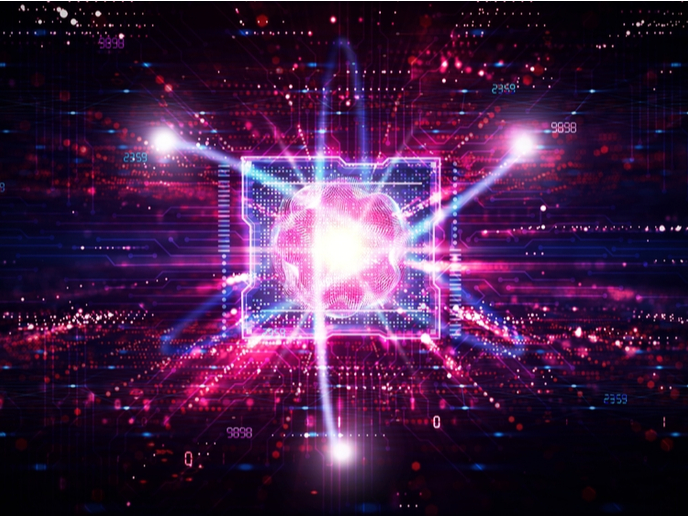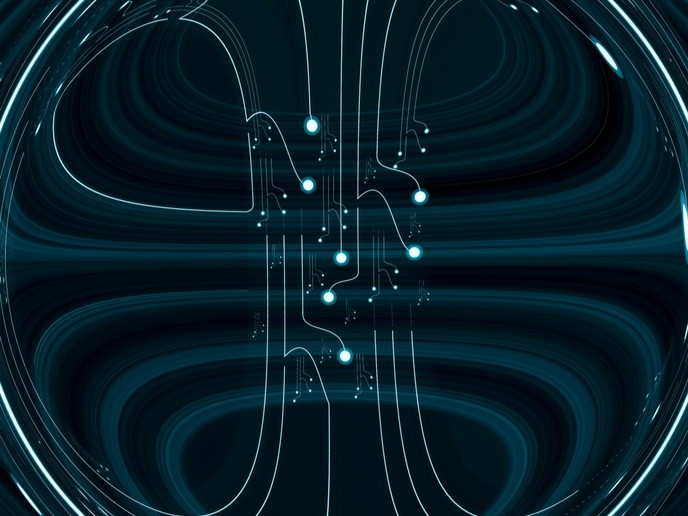Neuer Bioimaging-Detektor für die Tiefendarstellung von Gewebe
Die Detektion von Licht ist Grundlage vieler biomedizinischer Anwendungen. Bei vielen herkömmlichen Lichtdetektoren ist jedoch die Sensitivität zu niedrig, das Hintergrundrauschen zu stark und die zeitliche Auflösung nicht annähernd ausreichend. So könnten innovative Bildgebungsverfahren nicht nur die Diagnose vereinfachen, sondern auch grundlegende biologische Prozesse besser verständlich machen.
Supereffizienter Lichtdetektor
Das EU-finanzierte Projekt SQP entwickelte einen Detektor für Photonen (einzelne Lichtpartikel). Das Prinzip beruht auf einem Metallstreifen, der bei Abkühlung supraleitfähig wird und praktisch keinen elektrischen Widerstand mehr hat. Durch Absorption eines Photons erhöht sich der elektrische Widerstand geringfügig und ergibt einen messbaren Wert. Diese Art der Detektion ist effizienter und schneller als bei allen herkömmlichen Einzelphotonendetektoren. Ziel des SQP-Konsortiums war die wesentliche Optimierung von Komponenten und Entwicklung von Kerntechnologien für die Gewebebildgebung. „Unsere Technologie eignet sich für mikroskopische oder andere optische Analysen sowie die nicht-invasive Abbildung dynamischer zellulärer Prozesse in lebendem Gewebe, etwa die intrazelluläre Signalübertragung“, erklärt Sander Dorenbos, Projektkoordinator und Geschäftsführer von Single Quantum(öffnet in neuem Fenster). Beispiele sind hochauflösende Mikroskopie(öffnet in neuem Fenster), medizinische Endoskopie für die Echtzeitdiagnose und biomedizinische Bildgebung.
Einsatz in mikroskopischen und spektroskopischen Untersuchungen sowie bei Biomarkeranalysen
Zelluläre Strukturen und Vorgänge lassen sich mittels hochauflösender Lichtmikroskopie inzwischen gut darstellen. Für heterogenes Gewebe ist jedoch die mikroskopische Auflösung zu gering und das Hintergrundrauschen zu stark. In Zusammenarbeit mit der Universität Stanford integrierte das SQP-Konsortium den neuen Lichtdetektor in ein Mikroskop und führte mehrere Bioimaging-Experimente im NIR-II-Bereich (Nahinfrarot) zwischen 1 000 und 1 700 nm durch. Untersuchungen am Gehirn einer lebenden Maus(öffnet in neuem Fenster) mittels Einzelphotonendetektor ergaben eine tiefere Gewebedurchdringung und geringere Lichtstreuung als bei herkömmlichen Lichtdetektoren. Optische Spektroskopie(öffnet in neuem Fenster) ist ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich für den SQP-Detektor. Das Verfahren ist nicht-invasiv und sicher, und an den gemessenen Absorptionsspektren lassen sich physiologische Parameter wie Blutbestandteile und Sauerstoffsättigung ablesen. Das Licht dringt über optische Fasern(öffnet in neuem Fenster) in das Gewebe ein und wird entsprechend der Beschaffenheit des Gewebes gestreut oder absorbiert. Hämoglobin, Oxyhämoglobin, Wasser und Fett sind die wichtigsten lichtabsorbierenden Bestandteile in lebendem Gewebe und beeinflussen sehr spezifisch das gemessene Reflexionsspektrum. Mit optischer Spektroskopie können daher genaue Gewebeprofile erstellt und Echtzeitdaten zu chirurgischen Rändern etwa bei Tumorresektionen geliefert werden. Der SQP-Detektor kann hier Hilfestellung leisten, indem er Hintergrundrauschen und Lichtstreuung minimiert und die Gewebedurchdringung verbessert. SQP-Detektoren könnten zudem in der Biomarkerforschung und Diagnostik zum Einsatz kommen. Um klinische Ergebnisse zu prognostizieren, müssen oft spezifische Biomarker ermittelt werden, die dann als Indikatoren für bestimmte körperliche Zustände, Krankheiten und sogar pharmakologische Reaktionen auf therapeutische Interventionen dienen. „Der wichtigste Erfolg des Projekts war die Industrialisierung einer Technologie, die im Rahmen universitärer Forschung entwickelt wurde“, betont Dorenbos. SQP will nun seine Produktionskapazität und damit das Nutzungs- bzw. Anwendungsspektrum der Lichtdetektoren für den Markt erweitern. SQP-Detektoren können die Diagnostik auf Basis optischer Bildgebung erheblich vorantreiben und damit den Weg für eine bessere und kostengünstigere medizinische Versorgung ebnen.