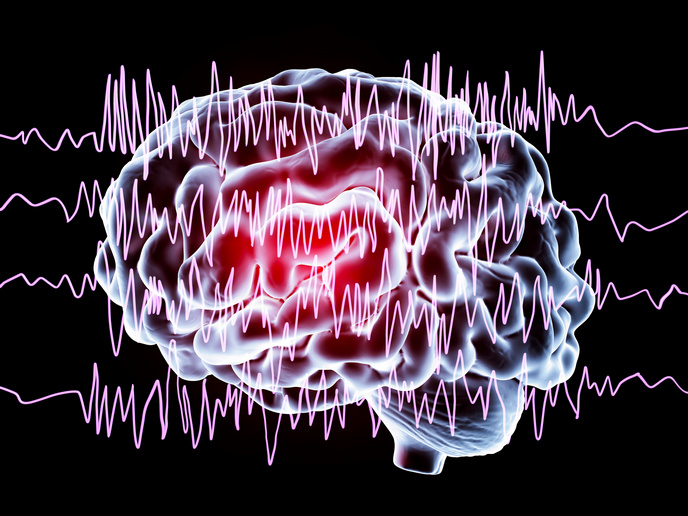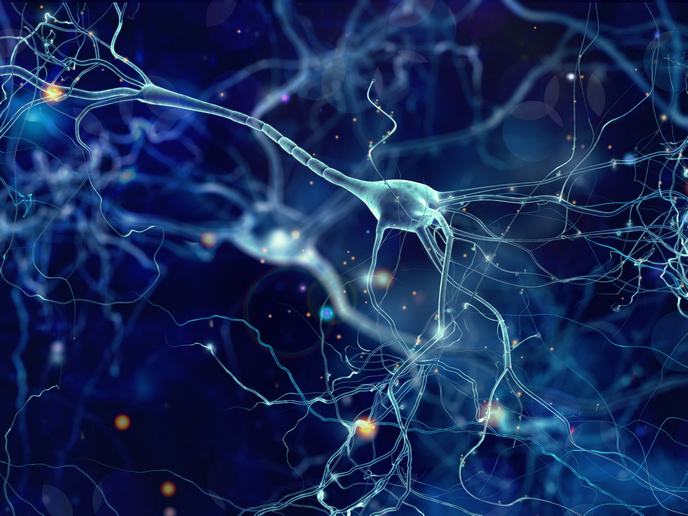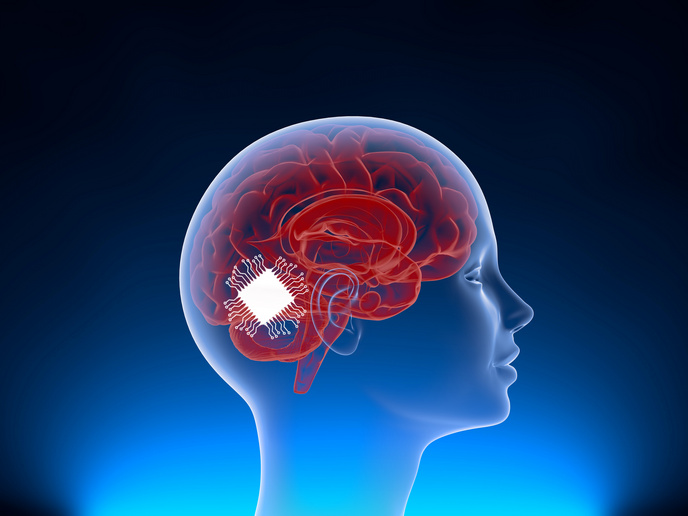Fortschritte bei MRT-gestützter Charakterisierung der Multiplen Sklerose
Multiple Sklerose (MS) ist eine entzündliche Autoimmunerkrankung, die weltweit das Zentralnervensystem von Millionen Menschen in Mitleidenschaft zieht und dabei motorische, sensorische, kognitive und emotionale Defizite verursacht. Bei Multipler Sklerose greift das Immunsystem die Myelinscheiden an, welche die Nervenfasern isolieren und die Signalübertragung gewährleisten. Zur Diagnose dienen etliche Verfahren aus dem Bereich der Magnetresonanztomografie, welche die verschiedenen Merkmale der Krankheit, etwa Plaques in der weißen Substanz, nachweisen können. Die Forschenden wenden außerdem die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) zur Beobachtung von Veränderungen in der Hirnfunktion bei MS und zur Durchführung der quantitativen Suszeptibilitätskartierung (Quantitative Susceptibility Mapping, QSM) an, um die Eisenverteilung innerhalb der Läsionen der weißen Substanz als Hinweis auf eine aktive Erkrankung zu bewerten.
Neue MRT-Verfahren
Der Nachweis von Plaques und Läsionen sowie die Bewertung der klinischen Symptome bilden die beiden Parameter, anhand derer die Betroffenen in die verschiedenen Krankheitsphänotypen(öffnet in neuem Fenster) eingeteilt werden: klinisch isoliertes Syndrom (KIS), schubförmig-remittierende MS (RRMS), primär-progrediente MS (PPMS) und sekundär-progrediente MS (SPMS). Das Hauptziel des Projekts MS-fMRI-QSM bestand in der Entwicklung eines Verfahrens, das gleichzeitig Informationen über im Frühstadium von MS auftretende funktionelle und strukturelle Veränderungen liefert. Daraus könnte sich die Chance ergeben, zu erkennen, welche Personen vom schubförmig-remittierenden in ein progressives Stadium übergehen. Die Forschungsarbeiten wurden mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) durchgeführt und beinhalteten die Entwicklung eines MRT-Verfahrens, mit dem bei einer einzigen Messung sowohl funktionelle als auch strukturelle Daten erfasst werden können. „In der MS-Forschung werden QSM- und fMRT-Scans getrennt erfasst, aber das ist entweder nicht immer realisierbar oder beide können durch Bewegungen verfälscht werden“, erklärt Marie-Skłodowska-Curie-Forschungsstipendiat Simon Robinson. Forschende erdachten nun ein neues Verfahren, mit dem sie hochauflösende QSM-Daten aus fMRT-Scans extrahieren konnten. Obwohl sich die Kombination aus QSM und fMRT als schneller erwies, war sie gegenüber technischen, durch Bildverzerrungen verursachten Artefakten anfällig. Mithilfe des MS-fMRI-QSM-Ansatzes(öffnet in neuem Fenster) gelang die Korrektur von Verzerrungen in der funktionellen Bildgebung und von durch die Atem- und Herztätigkeit verursachten Störeffekten.
Einblicke in die Mechanismen der Erkrankung
In den nächsten Schritten des wissenschaftlichen Teams wird die Qualität der mit diesem Verfahren erzeugten quantitativen Suszeptibilitätskartierungen bewertet und es werden Veränderungen in der Eisenverteilung und Funktionalität mit klinischen Symptomen in Verbindung gebracht. Anhand der Verknüpfung der Daten über die Eisenansammlung mit dem Wissen über Demyelinisierung und Störung funktioneller Netzwerke bei den verschiedenen Krankheitsphänotypen werden charakteristische Merkmale besser erkennbar. Zudem werden damit die Grundlagen für das Verständnis der Mechanismen gelegt, die dem Fortschreiten der Krankheit von einer schubförmig-remittierenden Ausprägung ohne Behinderung zu schubförmig-remittierender MS mit Behinderung zugrunde liegen. „Durch beschleunigte Datenerfassung und Generierung kolokalisierter Messungen von Struktur- und Funktionsveränderungen hoffen wir, den bildgebenden MS-Biomarkern auf die Spur zu kommen“, hebt Robinson hervor.
Vorteile und klinische Perspektiven
Einer der Hauptvorteile der MS-fMRI-QSM-Methode besteht in der bislang im Vergleich zu früheren fMRT-MS-Studien noch nie erreichten Auflösung. Außerdem gestatten wiederholte Scans ein besseres Verständnis des Ansprechens auf Behandlungen, sodass die Ärztinnen und Ärzte das Fortschreiten der Krankheit überwachen und gegebenenfalls die Medikation verändern können. Letztlich lautet das Ziel, Multiple Sklerose in einem früheren Stadium zu diagnostizieren, sodass die Betroffen mit einer Behandlung beginnen können, bevor die Schädigungen überhandnehmen. Es herrscht die Hoffnung, dass die fMRT-QSM-Bildgebung dazu beitragen wird, den Gesundheitszustand und die Lebenserwartung der Patientinnen und Patienten zu verbessern sowie die Belastung der Pflegekräfte und Gesundheitsdienste zu verringern. Darüber hinaus kann das Verfahren auf die Erfassung von quantitativen Suszeptibilitätskartierungsdaten bei einem ganzen Spektrum anderer Pathologien ausgeweitet werden.