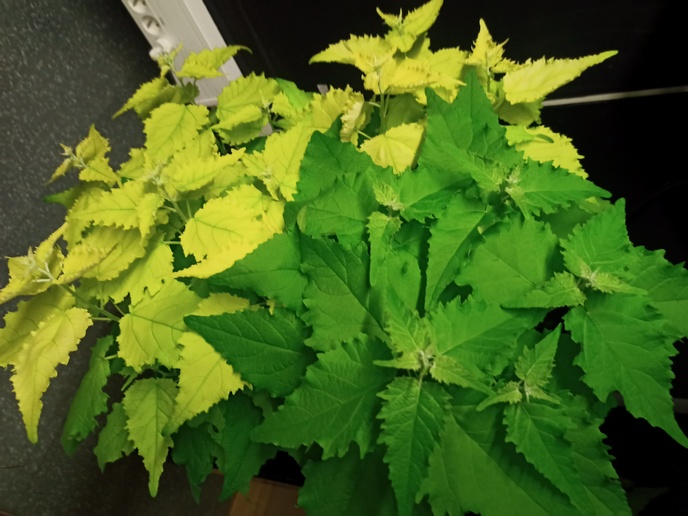Wie sich das Bodenmikrobiom selbst organisiert, um den Kohlenstoffkreislauf anzukurbeln
Boden ist ein wichtiger Kohlenstoffspeicher – aus mikroskopisch kleinen Gründen. Mikroben im Boden zersetzen unentwegt Pflanzenmaterial. Dabei wird etwas CO2 in die Atmosphäre freigesetzt, doch weitaus mehr Kohlenstoff in der Bodenstruktur gespeichert. „Über Jahrtausende hinweg hielt diese mikrobielle Aktivität nicht nur den Kohlenstoffkreislauf zwischen Land und Atmosphäre im Gleichgewicht, sondern baute auch enorme Kohlenstoffreserven in Böden auf“, erklärt Christina Kaiser(öffnet in neuem Fenster), außerordentliche Professorin am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien. „Wir verstehen jedoch noch immer nicht vollständig, welche Mechanismen den mikrobiellen Abbau organischer Bodensubstanz antreiben.“ Das Bodenmikrobiom funktioniert auf unglaublich kleiner Maßstabsebene. Wir verstehen immer noch nicht, wie mikrobielle Interaktionen in einer räumlich komplexen Umgebung wie dem Boden den gesamten Prozess des Umsatzes organischer Substanz auf Systemebene vermitteln. Im Projekt SomSOM, das vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) finanziert wurde, werfen Kaiser und ihr Team ein neues Licht auf dieses unterirdische System: Sie erforschen die Interaktionen zwischen Mikroben durch die Linse der komplexen Systemwissenschaft. Theorien auf diesem Gebiet legen nahe, dass Interaktionen auf der Mikroebene – in einem Prozess namens „Selbstorganisation“ – zu emergenten Verhaltensweisen auf Systemebene führen können, die sich für einzelne Teile nicht prognostizieren lassen. „Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass das Verhalten komplexer Systeme für die Bodenfunktion eine zentrale Rolle spielt“, sagt Kaiser. „Diese Perspektive ist von entscheidender Bedeutung, um vorherzusagen, wie Böden auf Umweltveränderungen reagieren werden – und wie sie die Kohlenstoffbilanz der Erde in der Zukunft beeinflussen werden.“
Entdeckung der Selbstorganisation in Gemeinschaften der Bodenmikroben
Das Team untersuchte, wie sich Bodenmikroben über verschiedene räumliche Maßstäbe hinweg „selbst organisieren“. Zu diesem Zweck kombinierte es Experimente im mikroskopischen Maßstab mithilfe von Computermodellen, um zu untersuchen, wie Mikroben beim Abbau komplexer Substanzen zusammenarbeiten. Um Nahrungsquellen freizusetzen, müssen Mikroben Enzyme produzieren und sie in ihre Umgebung abgeben. Wie das Projekt zeigt, ist die Wirksamkeit dieser Enzyme stark von der Mikroporenstruktur des Bodens abhängig. Dies führt für die Mikroben zu ein Kompromiss, dem „Kipppunkt“, an dem kleine Änderungen der Umweltbedingungen dramatische Verschiebungen in der mikrobiellen Aktivität zur Folge haben können. Auf größeren Maßstabsebenen wurde evident, dass die durch mikrobielle Aktivitäten entstandene Bodenstruktur im Millimeterbereich mikrobielle Gemeinschaften formt und sie mit spezifischen Teilen organischer Substanz verbindet, was sich auf ihre Ökologie und Evolution auswirken könnte. In Böden aus etablierten Langzeit-Feldversuchen bestimmte das Team auch die Rolle des Bodenmikrobioms auf Ökosystemebene. In österreichischen Grünlandgebieten hatte der Nährstoffmangel im Laufe von 70 Jahren komplexe Verschiebungen bei den Bodenpilzen verursacht, die wiederum die Pflanzengemeinschaften und die Bodenchemie verändert hatten. In Island zeigten Studien entlang eines natürlichen geothermischen Gradienten, dass Böden bei Umweltveränderungen kritische Kipppunkte überschreiten können. Die Ergebnisse wurden in einer Reihe von Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht, darunter „Nature Geoscience“, „ISME Journal“ und „PLOS Computational Biology“. Sie wurden auch auf mehreren Konferenzen vorgestellt, sowohl innerhalb der Bodenforschungs-Gemeinschaft als auch bei Tagungen zu komplexen Systemen und mathematischer Modellierung.
Erweiterung unseres Wissens über mikrobielle Ökosysteme im Boden
Insgesamt hat das Projekt unser Verständnis mikrobieller Ökosysteme im Boden durch einen Ansatz erweitert, der in dieser Disziplin in der Regel nicht verwendet wird, und den ersten Beweis dafür erbracht, dass die Dynamik komplexer Systeme den Kohlenstoffumsatz im Boden mitgestaltet. „Indem es Ideen aus der mikrobiellen Ökologie, der Bodenkunde und der Theorie komplexer Systeme kombiniert, hat uns das Projekt eine neue Perspektive dafür eröffnet, wie der Umsatz organischer Bodensubstanz und die Reaktion auf Umweltveränderungen gesteuert werden“, fügt Kaiser hinzu. „Dies stellt für den derzeitigen Stand der Bodenforschung einen bedeutenden Schritt nach vorne dar.“