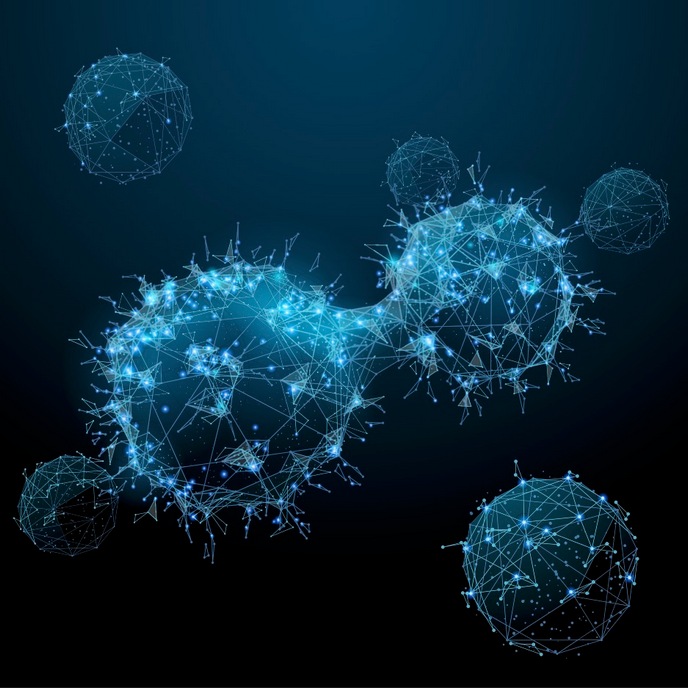Fortpflanzuungsfähigkeit von Fischen
Welche genauen Auswirkungen hat die Umweltverschmutzung auf die Fruchtbarkeit? Wie weit sind diese Auswirkungen verbreitet? Beim Versuch, diese Fragen zu beantworten, lieferten frühere Untersuchungen am Sperma von verschiedenen Säugetieren Anhaltspunkte für eine mögliche Östrogenwirkung von Umweltschadstoffen auf Spermazellen. Bei Toxinen wie z.B. Quecksilber (um nur eine der möglichen Substanzen zu nennen) hatte man bereits nachgewiesen, dass sich diese unmittelbar auf die Sperma-Flagella auswirken und so deren Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Bis jetzt wurde jedoch in keiner Studie der genaue Zusammenhang zwischen Umweltschadstoffen und der abnehmenden Spermienbeweglichkeit bei Fischen gefunden. Daher wurden neue Untersuchungen an Fischsperma durchgeführt, bei denen unter Anwendung von elektronenmikroskopischen Verfahren detailliertere Daten über die Rolle von Schadstoffen bei der Fruchtbarkeit gesammelt wurden. Fischsperma eignet sich für solche Untersuchungen besser als Spermaproben von Säugetieren, weil es nur für Minuten nach dem Kontakt mit Wasser seine Beweglichkeit beibehält und somit als schnelles und zuverlässiges Hilfsmittel zur Gewinnung quantitativer Daten über die Auswirkungen von Umweltschadstoffen dienen kann. Allerdings war die Ausarbeitung einer Methodik zur Ermittlung der Beweglichkeit wegen der morphologischen Unterschiede zwischen Fisch- und Säugetiersperma mit Schwierigkeiten verbunden. Erst der Einsatz eines Messsystems zur computergestützten Spermienanalyse (Computer Assisted Sperm Analysis, CASA) in Verbindung mit einer automatisierten Spermien-Morphologieanalyse (Automated Sperm Morphology Analysis, ASMA) lieferte exakte Detailergebnisse. So konnten mit diesem Projekt die Auswirkungen der Wasserverschmutzung auf die Spermienbeweglichkeit gut dokumentiert werden. Im Endergebnis wurden dabei durch eine effektive Methodik auf der Grundlage dieser beiden Prozesse und durch die Möglichkeit einer Spermienmorphologieanalyse detaillierte Standards für die Messung der Spermienbeweglichkeit sowie Techniken zur Kältekonservierung erarbeitet. Sowohl bei In-vivo- als auch In-vitro-Analysen können so die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Spermienbeweglichkeit untersucht werden. Diese Vorgehensweise stellt eine Alternative zu den komplexen und hoch entwickelten endokrinologischen Studien zur Fortpflanzungsfähigkeit dar, die bislang zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Fruchtbarkeit und Umweltschäden angewandt werden. Sie dürfte unser Verständnis für diese Thematik enorm verbessern und durchaus zur Schaffung einer realisierbaren und wirtschaftlichen Lösung beitragen, die fundiertere Antworten liefert als bisher.