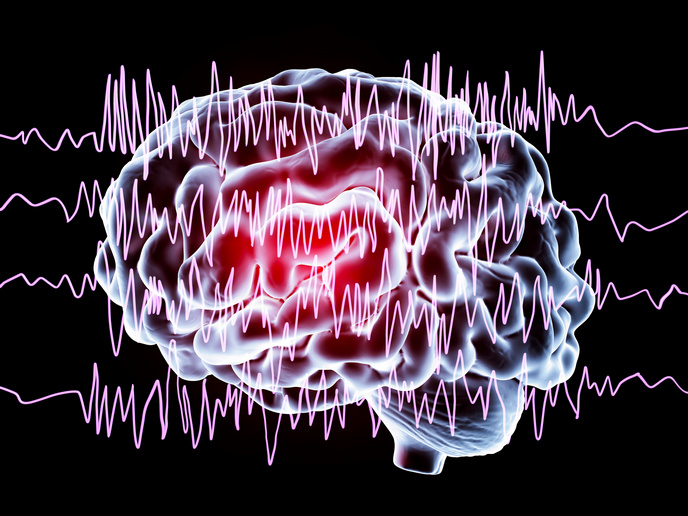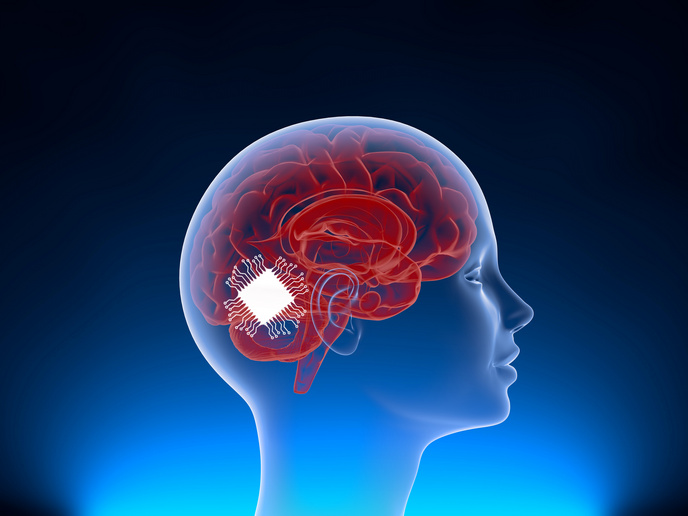Wie unser Gehirn bestimmt, woran wir uns erinnern
Das ACCESS2WM-Projekt, das durch Einzelstipendien im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen finanziert wird, hat sich damit beschäftigt, wie Informationen beim Zugriff auf das menschliche Arbeitsgedächtnis für visuelle Informationen priorisiert werden. Dr. Freek van Ede, Stipendiat und leitender Forscher, erklärt dazu: „Das Arbeitsgedächtnis ist ein wesentlicher Baustein der adaptiven Kognition, der es uns ermöglicht, frühere sensorische Informationen in Antizipation zu behalten, um später gegebenenfalls als Orientierungshilfe bei der Wahrnehmung und Handlung darauf zurückzugreifen.“ Antizipation und Hirnwellen steuern den Zugriff Da die Kapazität des Gehirns beschränkt ist, ergibt es Sinn, dass es für das Arbeitsgedächtnis solche Informationen auswählt, die voraussichtlich am relevantesten sein werden. Die Forscher befassten sich daher mit den kognitiven und neuronalen Mechanismen, die den Zugriff auf diesen wichtigen Zwischenspeicher im Gehirn steuern. Mittels Elektroenzephalographie untersuchten sie, welchen Einfluss die Antizipation darauf hat, dass erinnerungswürdige Zielinformationen – anstelle von konkurrierenden Distraktoren – ausgewählt werden. „Wir konnten neue Mechanismen identifizieren, nach denen antizipatorische Gehirnzustände die Verarbeitung von [erinnerungswürdigen] Zielinformationen gegenüber temporär konkurrierenden Distraktoren priorisieren“, berichtet Dr. Van Ede. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Antizipation nicht nur die visuellen Zielrepräsentationen verstärkt, sondern auch die Interferenz bei diesen Zielrepräsentationen hinauszögert, die durch temporär umgebende Distraktoren verursacht werden. Nach näherer Untersuchung der neuronalen Mechanismen, die dem priorisierten Gedächtniszugriff zugrunde liegen, stellten die Forscher von ACCESS2WM außerdem einen Zusammenhang zwischen dieser Art des Zugriffs und bestimmten physiologischen Gehirnzuständen vor der Gedächtniskodierung fest. Insbesondere bei verlangsamten Oszillationen im Alphabandbereich von 8-12 Hz, d. h. den dominanten Gehirnwellen, können Zielinformationen gegenüber konkurrierenden Distraktoren leichter priorisiert werden. Weite Verbreitung dank Unterstützung durch das Marie-Curie-Stipendium Über den zweijährigen Projektzeitraum von ACCESS2WM betreute Dr. van Ede das Projekt federführend in allen Forschungsaspekten, einschließlich Versuchsanordnung, Datenerhebung, Analysen und Verbreitung. Ein umfassender Bericht über das Experiment zu Antizipation und Gehirnwellen wurde bereits in Natur Communications(öffnet in neuem Fenster) veröffentlicht. Darüber hinaus wird die Veröffentlichung von zwei weiteren wichtigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Zugriff auf und aus dem Arbeitsgedächtnis erwartet. Der Stipendiat hat gemeinsam mit seinen Kollegen von der Universität Oxford außerdem mehrere Fachartikel geschrieben, die in angesehenen Fachschriften wie Nature Reviews Neuroscience(öffnet in neuem Fenster) und Trends in Neurosciences(öffnet in neuem Fenster) erschienen sind. „Ich habe außerdem mehrere einschlägige Forschungsprojekte im Gastlabor betreut, von denen viele bereits Publikationen mit Erst- und/oder Letztautorenschaft verzeichnen konnten“, ergänzt Dr. van Ede. Dazu rundeten Vorträge auf verschiedenen internationalen Konferenzen sowie an anderen Universitäten das ausgesprochen umfassende Forschungs- und Verbreitungsprogramm ab. Eine Vielzahl neuer Protokolle für künftige Forschungsvorhaben Im Laufe des Projekts haben die Forscher von ACCESS2WM ihre Untersuchungsmethoden optimiert und dabei auch mehrere Verfahren zur Untersuchung des Arbeitsgedächtnisses entwickelt. Dazu gehören unter anderem neuartige Protokolle zur Verfolgung der Aufmerksamkeitszuwendung sowie der Einsatz von hochmodernen multivariaten Analysen und Eyetracking-Analysen zur Verfolgung der kognitiven Repräsentationen in dynamischen Umgebungen. Fehlfunktionen des Arbeitsgedächtnisses gelten weithin als zentraler Faktor bei kognitiven Störungen, deren Prävalenz in der heutigen Gesellschaft zunimmt – ein klassischen Beispiel hierfür ist ADHS. Es ist durchaus denkbar, dass solche Defizite zumindest teilweise auf eine nicht-adaptive Steuerung des Informationszugriffs auf und aus dem Arbeitsgedächtnis zurückzuführen sind. Diese Erkenntnisse bieten eine beträchtliche Chance für die Entstehung neuer Forschungsrichtungen und möglicherweise sogar auch für therapeutische Strategien. „In dieser Hinsicht stellt das Projekt ein ausgezeichnetes Sprungbrett für mehrere neue Forschungszweige dar, die wir – wie hoffentlich auch viele andere – in den nächsten Jahren verfolgen möchten“, so Dr. van Ede abschließend.