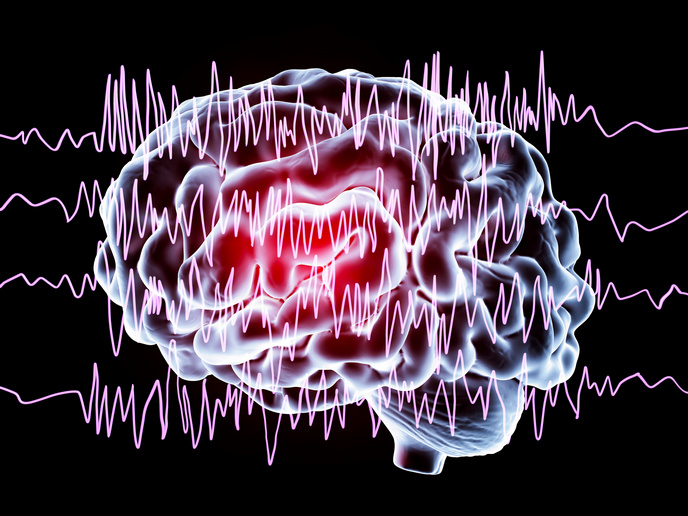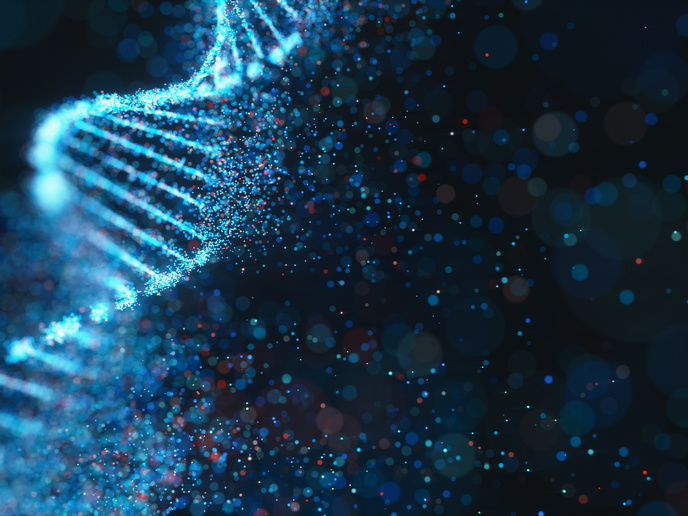Aus dem Bauch heraus: Wie der Darm mit dem Gehirn kommuniziert
Von Adipositas bis hin zu Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebsarten – viele der drängendsten Gesundheitsprobleme der Welt hängen mit dem Stoffwechsel zusammen, jenem Prozess, mit dem der Körper Nährstoffe in die für das Wachstum, das Heilen und Funktionieren benötigte Energie und erforderlichen Materialien umwandelt. Das Gehirn ist der Hauptkoordinator des Stoffwechsels, wo die Informationen über die verzehrte Nahrung eingehen, aber Adipositas kann bewirken, dass diese Informationsautobahn nicht richtig funktioniert. „Die Forschung deutet darauf hin, dass Adipositas die Kommunikation zwischen dem Darm und dem Gehirn stört, was übermäßiges Essen und eine Deregulierung des Stoffwechsels nach sich zieht“, sagt Henning Fenselau(öffnet in neuem Fenster), Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung(öffnet in neuem Fenster). Es stellt sich die Frage, welche spezifischen Neuronentypen an diesem Prozess beteiligt sind. „Zu verstehen, wie diese Neuronen funktionieren und wie sie durch Adipositas gestört werden, könnte die Tür zur Entwicklung neuer, gezielterer Therapien für Stoffwechselkrankheiten aufstoßen“, fügt Fenselau hinzu. Bei der Beantwortung dieser Frage hilft das EU-finanzierte Projekt GuMeCo.
Verschiedene Arten sensorischer Neuronen sind auf die Wahrnehmung bestimmter nahrungsbezogener Signale spezialisiert
Das Ziel des vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) (ERC) unterstützten Projekts bestand darin, das Geheimnis zu lüften, wie das Nervensystem die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn nutzt, um den Stoffwechsel zu regulieren. Zu diesem Zweck entwickelte das Team ein fortgeschrittenes System zur gezielten Genmodifikation, mit dem die Forschenden spezifische Subtypen von sensorischen Neuronen mit bisher unerreichter Präzision untersuchen können. „Dieser hochmoderne Ansatz bietet eine leistungsstarke Plattform, um aufzudecken, wie die Darm-Hirn-Signalübertragung zu metabolischer Gesundheit und Krankheit beiträgt“, erklärt Fenselau, der das Projekt koordiniert. Unter Einsatz dieser Plattform entdeckte er, dass verschiedene Typen sensorischer Neuronen darauf spezialisiert sind, bestimmte nahrungsbezogene Signale zu erkennen und spezifische Signalwege im Gehirn zu aktivieren, die die Nahrungsaufnahme und den Blutzuckerspiegel regulieren. Laut Fenselau tragen diese Erkenntnisse bei den Forschenden wesentlich zum Verständnis bei, wie das Nervensystem zur Regulierung des Energiehaushalts und des Stoffwechsels beiträgt. „Dieses Wissen legt den Grundstein für die Ermittlung der bei Adipositas oder Diabetes nicht richtig funktionierenden neuronalen Schaltkreise, was zur Entwicklung neuer, zellspezifischer Behandlungen für diese weitverbreiteten Krankheiten führen könnte“, berichtet er. Die Ergebnisse wurden in „Cell Metabolism“(öffnet in neuem Fenster) veröffentlicht und im Folgenden überaus häufig zitiert.
Entdeckungen in Neurowissenschaften und Stoffwechsel- und Adipositasforschung beschleunigen
Während im Rahmen des Projekts GuMeCo bereits unser Verständnis der Darm-Hirn-Kommunikation bei der Stoffwechselregulierung neu definiert wurde, gilt dies in Bezug auf die dauerhaften Auswirkungen nur als die Spitze des Eisbergs. Beispielsweise werden die projektintern entwickelten Instrumente und Modelle weiterhin von Forschenden weltweit genutzt, um Entdeckungen in den Bereichen Neurowissenschaften, Stoffwechsel- und Adipositasforschung zu beschleunigen. Tatsächlich hat der Nobelpreisträger Ardem Patapoutian Interesse an den projekteigenen transgenen Mausmodellen bekundet. Fenselau erhielt außerdem eine Finanzhilfe, den ERC Consolidator Grant, um die mit den sensorischen Neuronen verbundenen Gehirnschaltungen genauer zu erkunden. „Die Arbeit von GuMeCo bildetet einen bedeutenden Schritt auf dem Weg, eines der komplexesten Systeme der Biologie zu entschlüsseln und dieses Wissen in Strategien umzusetzen, die zur Bekämpfung einiger der am weitesten verbreiteten gesundheitlichen Probleme unserer Zeit beitragen können“, schließt Fenselau seine Ausführungen.