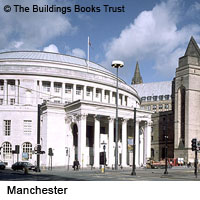Studie: Universitäten spielen in der regionalen Wissensökonomie eine zentrale Rolle
Als die wichtigsten Wissensproduzenten spielen Universitäten eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Entwicklung regionaler Wissensökonomien. Aber mangelndes unternehmerisches Denken und das Fehlen einer stabilen Technologietransferinfrastruktur zwischen Industrie und Hochschule sind nach wie vor die wichtigsten Innovationsbarrieren. Das sind einige der zentralen Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Studie der European University Association (EUA). Wissen gilt heute als globalisiertes Produkt, das keine Grenzen kennt, und auch "Wissensarbeiter" und Unternehmen werden immer mobiler. Dennoch betonen sowohl Politiker als auch Experten seit geraumer Zeit die Bedeutung der Dimension "Ort" für das Wachstum der Wissensökonomien. Sie weisen darauf hin, dass Wissen einen sogenannten Spill-Over-Effekt hat, das heißt, Menschen und Unternehmen siedeln sich in unmittelbarer Nähe zueinander an. Das wiederum hat das Entstehen und die Entwicklung regionaler Wissensökonomien gefördert, die erheblichen wirtschaftlichen Nutzen gebracht haben. Auch die regionalen Behörden haben die Bedeutung dieser Cluster für die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Region erkannt und konzentrieren sich verstärkt auf die Wissensökonomie und deren Bedürfnisse, insbesondere auf die Netzwerkfähigkeit und die Unterstützungsstrukturen, die in der Region entstanden sind. Im Rahmen der Studie wurden vier europäische Stadt-Regionen (Barcelona, Brünn, Manchester und Öresund) untersucht. Alle Schlüsselelemente einer innovativen Region, so fand man heraus, werden dort gefördert. Dazu gehören unter anderem das Wachstum hochmoderner Dienstleistungs- und Wirtschaftssektoren, die Förderung der Wissenskultur, Investitionen in die Gemeinde und in Bildung sowie ein Pool an sehr gut ausgebildeten Fachkräften. Diese Regionen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie perfekte Bedingungen für die Interaktion zwischen den wichtigsten Wissens- und Innovationsstrukturen - nämlich Universitäten, Regierung und Unternehmen - geschaffen haben. Die Studie beschreibt auch, wie diese Regionen die Öffentlichkeit erfolgreich in die Prozesse der Wissensgenerierung eingebunden haben. Angesichts dieses neuen Kontexts sind alle diese Strukturen, nicht zuletzt die Universitäten, stärker ins Blickfeld geraten. Es wird hinterfragt, ob das Wissen, das in den Universitäten generiert wird, die Art von Wissen ist, die die Wissensökonomie braucht, und ob die Kanäle, durch die dieses Wissen in die Produktionsprozesse fließt, tatsächlich die Erwartungen erfüllen. Die Universitäten, so die Studie, erfüllen ihre Rolle als wichtige Wissensproduzenten, nicht nur in Bezug auf wissenschaftliche und technische Entwicklungen sondern auch in Bezug auf gesellschaftliche und kulturelle Phänomene. Das Phänomen der Wissensökonomie sowie die Bedeutung von Regionen, Clustern und der Interaktion mehrerer Akteure für die Wissensentwicklung wurden identifiziert, untersucht und erklärt - zunächst durch Hochschulforscher und Lehrer. Am wichtigsten: Universitäten bilden und schulen Absolventen für die Wissensregion. Die Studie weist darauf hin, dass alle vier untersuchten Wissensregionen stolz darauf sind, mehr solcher Absolventen für ihre expandierenden Wissensökonomien anzubieten als konkurrierende Regionen. Obwohl diese Aufgabe von den Universitäten sehr ernst genommen wird und die Lehrpläne und Bestimmungen permanent revidiert werden, tauchen laut Autoren der Studie immer wieder Probleme auf. So entsteht zum Beispiel ein Ungleichgewicht, wenn die Kompetenzen von Innovatoren, Forschern, Technikern oder Managern nicht an die Aufgaben, die sie erfüllen müssen, angepasst sind. Die Autoren sind der Ansicht, dass gewisse Korrekturen notwendig sind, um die Hochschulabsolventen auf die Herausforderungen der aktuellen und künftigen regionalen Wissensökonomie vorzubereiten und ihre Kompetenzen entsprechend zu gestalten. Obwohl schon viele Kanäle bestehen oder gerade eingerichtet werden, die die Entwicklung oder Anpassung von Kompetenzen verbessern, so hat laut Studie nur eine Region eine regionale Kompetenz-Partnerschaft eingerichtet, bei der unterschiedliche Universitäten, Bildungseinrichtungen und Arbeitgeber ihren Bedarf und die Abdeckung des Bedarfs diskutieren können. Die befragten Vertreter regionaler Behörden äußerten sich darüber hinaus besorgt über den allgemein nur schwach entwickelten Unternehmergeist, nicht nur unter den Studenten, sondern auch unter den Forschern. Viele wiesen darauf hin, dass die Hochschulen nicht notwendigerweise optimal für die Vermittlung unternehmerischen Wissens geeignet sind. Daher wird mancherorts eine entsprechende Ausbildung von Universitäten und Unternehmen gemeinsam und mit Unterstützung regionaler Behörden konzipiert. In anderen Fällen bieten zwar Universitäten solche Kurse an, die aber von Praktikern aus Unternehmen unterrichtet werden. Die wichtigste Aufgabe der Universitäten ist es jedoch, eine solide Forschungsbasis zu schaffen, und die Untersuchung hat ergeben, dass die Universitäten dies auch tun - mit zwei Ausnahmen: Anwendbarkeit der Forschung und Technologiewissenstransfer. Viele Institutionen legen laut Studie zwar sehr hohen Wert auf Spitzenleistung sowohl in Bezug auf Forschungsqualität als auch auf Forschungskapazität, vernachlässigen jedoch oft die Anwendbarkeit der Forschung, da diese, so eine manchmal geäußerte Meinung, die Forschungsqualität schwäche. Paradoxerweise möchten die Universitäten jedoch unbedingt Zugang zur Technologietransferinfrastruktur, sagen aber, sie verfügten weder über die erforderlichen Mittel noch - in manchen Bereichen - über das erforderliche Fachwissen. Die meisten der untersuchten Institutionen haben in den letzten zwei oder drei Jahren Technologietransferbüros eingerichtet, verfügen aber nicht über ausreichend Mitarbeiter, um alle anstehenden Aufgaben bewältigen zu können. Die Studie weist darauf hin, dass es sehr zeitaufwändig ist, in einer kritischen Masse an Professoren das Interesse an Innovation und Unternehmertum zu wecken und dass den meisten Institutionen die notwendigen Humanressourcen dazu fehlen. Darüber hinaus lehnt in drei der fünf Länder, in denen die vier Fallstudien durchgeführt wurden, nach Ansicht der Universitäten, Unternehmen und Regierung die Mehrheit der Hochschulforscher den Gedanken nach wie vor ab, zur kommerziellen Innovation beizutragen. Aber, so die Autoren der Studie, in kurzer Zeit hat sich schon viel geändert. An allen vier untersuchten Orten öffnen sich immer mehr Professoren der Innovation und der Kooperation mit der Industrie und zeigen ein entsprechendes Interesse. Je mehr Grundlagenforscher auch Unternehmergeist zeigen - und begeistert von beiden Arten der Forschungstätigkeit sind - desto mehr beginnen sich auch die konservativeren Vertreter der Forschergemeinde zu ändern. Die nationalen Behörden reagieren auf den Bedarf für bessere Technologietransferinfrastrukturen, und viele europäische Regierungen haben in jüngster Zeit Hochschulfonds für Innovation eingerichtet. Diese Fonds vergeben entweder Forschungsmittel an Universitäten oder an Kooperationen zwischen Universitäten und Unternehmen, oder sie stellen einen "dritten Mittelfluss" dar. Diese Mittel werden dann auf der Basis einer breiteren Palette an ökonomisch relevanten Aktivitäten mit nicht-akademischen Partnern vergeben. Solche Finanzierungskanäle sollen die Netzwerkfähigkeit von Universitäten mit ihrem Umfeld verbessern und so indirekt die regionalen Wissensnetzwerke fördern. Auch wenn regionale Behörden im Allgemeinen über Finanzierungsmechanismen oder strikte Regulierung keinen signifikanten Einfluss auf das Verhalten von Universitäten ausüben, so nutzen sie doch laut Studie ihre Kompetenzen gezielt, um Universitäten und Industrie zusammenzubringen. So sind sich regionale Behörden durchaus bewusst, dass Universitäten flexible Räume und qualitativ hochwertige Infrastrukturen brauchen, wenn sie wettbewerbsfähige Forschung und Innovation bieten möchten, und stellen daher oft Räumlichkeiten und Einrichtungen für gemeinsame Projekte von Universitäten und Unternehmen zur Verfügung.