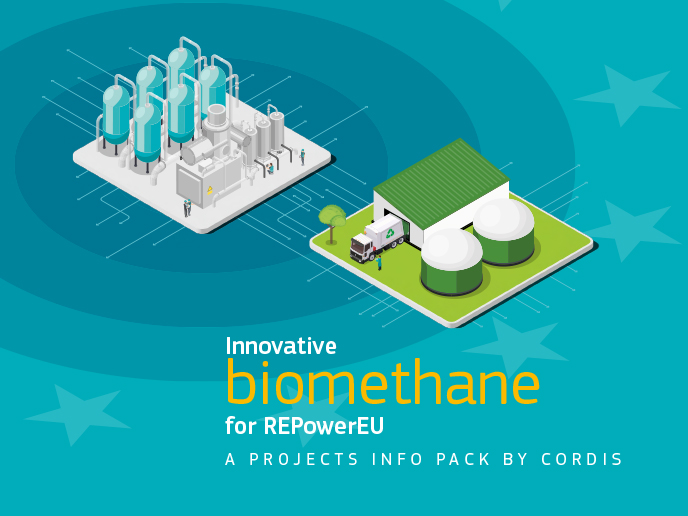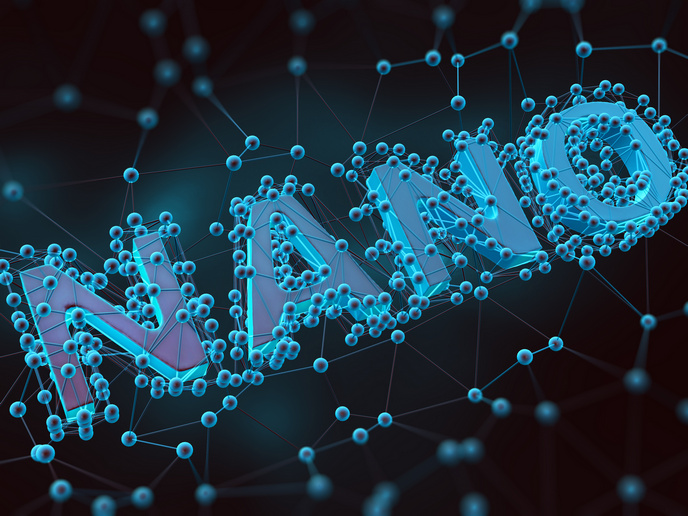Licht in die Photosynthese bringen
Pflanzen sind zunehmend Gegenstand industrieller Anwendungen, vom Anbau organischer Masse für den Einsatz als Biokraftstoff bis hin zur großtechnischen Produktion begehrter Chemikalien wie Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel. All diesen Prozessen liegt die Notwendigkeit zugrunde, Sonnenenergie so effizient wie möglich in Biomasse umzuwandeln, was im Mittelpunkt des EU-finanzierten Projekts SE2B(öffnet in neuem Fenster) steht. Dieser Austausch ist bei Pflanzen oft herunterreguliert, denn während sie typischerweise wachsen, um so viel Licht wie physikalisch möglich zu absorbieren, kann das Vorhandensein von überschüssiger Energie auf metabolischer Ebene schädlich sein.
Überschussenergie
„Pflanzen haben eine Regulierung, die aktiviert werden kann, um Energie loszuwerden, wenn zu viel Licht einfällt“, erklärt Claudia Büchel, Projektkoordinatorin von SE2B. „Das ist Physik: Sie bekommen genau so viel Licht, wie geliefert wird, das kann zu viel oder zu wenig sein.“ Um optimal zu gedeihen, organisieren Pflanzen ihre Stoffwechselwege um die durchschnittliche Lichtmenge herum, die sie erwarten. Die Identifizierung der Proteine, die dieses Fenster steuern sowie das Verständnis, wie genau diese funktionieren, könnte es uns ermöglichen, diesen Vorgang so zu optimieren, dass die Pflanze mit unterschiedlichen Raten der Lichtabsorption arbeiten kann. „Wenn wir diese Einschränkung außer Kraft setzen können, so können wir bessere Toleranzen einstellen und ein effizienteres Wachstum erreichen“, so Büchel. Zum Beispiel werden die meisten Mikroalgen in großen Tanks gezüchtet, wo eine gleichmäßige Lichtzufuhr schwierig ist. Die Flüssigkeit muss ständig bewegt werden, um die Algen umzuwälzen, was teuer ist. Die Algen so zu verändern, dass sie über ein breiteres Spektrum von Lichtintensitäten Photosynthese betreiben, könnte diese Kosten senken.
Suche nach Ähnlichkeiten
Von der Goethe Universität Frankfurt(öffnet in neuem Fenster) in Deutschland leitete Büchel ein Konsortium von 11 Organisationen, darunter Forschungsgruppen und kommerzielle Unternehmen, um den biologischen Prozess der Photosynthese besser zu verstehen. Die Arbeit umfasste drei Komplexitätsebenen, die von der Analyse der Proteinstruktur in lichtsammelnden Organellen bis hin zur Messung von Pflanzenphänotypen reichten. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Ähnlichkeiten und Unterschiede derjenigen Organismen, die am häufigsten in biotechnologischen Ansätzen sowie in der Landwirtschaft eingesetzt werden, so etwa Cyanobakterien, Grünalgen, Kieselalgen und höhere Pflanzen. Eine weitere zentrale Fragestellung war, wie die Effizienz des Energietransfers von Lichtsammler-Proteinen an Stoffwechselprozesse verbessert werden kann. „Als Biologin finde ich es faszinierend zu sehen, wie Organismen mit den gleichen Problemen konfrontiert werden und unabhängig voneinander Ausgleichsmechanismen entwickeln“, fährt Büchel fort. „Man findet immer wieder neue Dinge und neue Wege.“
Veröffentlichte Arbeiten
Als Ergebnis dieser Studien, sagt Büchel, „kennen wir jetzt einige Methoden, wie man diese Pflanzen verbessern kann, obwohl diese noch getestet werden müssen.“ Die Arbeit wird wahrscheinlich in der Biotechnologie zum Einsatz kommen, welche Algen zur Zucht gewünschter Chemikalien verwendet. Einige der im Laufe der vierjährigen Untersuchung entwickelten Hardwareentwicklungen oder -verbesserungen wurden bereits kommerzialisiert, wie z. B. automatisierte Anlagen zur Pflanzenphänotypisierung und hyperauflösende Lichtmikroskope, wobei weitere folgen werden. Dieses Forschungsvorhaben wurde im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) durchgeführt. Büchel meint, dass diese Finanzierung „enorm“ geholfen hat und weist darauf hin, dass die durch die Förderung unterstützten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre beruflichen Netzwerke erweitern konnten, wodurch sie in Folge Positionen im akademischen oder industriellen Sektor gefunden haben. Die Gruppe veröffentlicht weiterhin Ergebnisse(öffnet in neuem Fenster) aus der Studie. Eine vollständige Liste ist auf der Projektwebsite verfügbar.