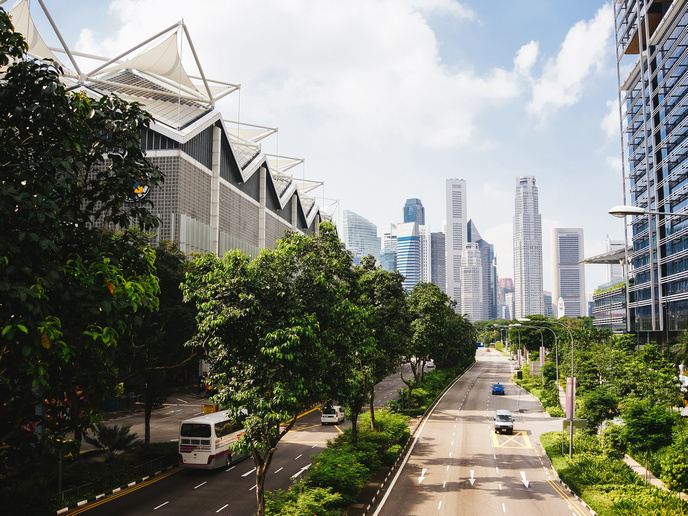Forschung an wirtsspezifischer Abwehr gegen Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus(öffnet in neuem Fenster) (S. aureus) ist für ein breites Spektrum von inner- und außerhalb von Krankenhäusern erworbenen Infektionen wie Endokarditis und Lungenentzündung verantwortlich und stellt die zweithäufigste Todesursache aufgrund bakterieller Resistenzen(öffnet in neuem Fenster) dar. Obwohl S. aureus lange als extrazelluläres Pathogen galt, geht die Forschung zunehmend davon aus(öffnet in neuem Fenster), dass das Bakterium auch internalisiert werden und sich in nicht-phagozytischen Zellen replizieren kann. Welche Wirtsfaktoren diesen intrazellulären Lebenszyklus begünstigen, ist allerdings kaum erforscht.
Molekulare Einblicke zur Interaktion zwischen Wirt und Bakterium
Um das komplexe Zusammenspiel zwischen Wirt und Pathogen genauer zu erkunden und Faktoren zu benennen, die Bakterien resistent machen, lag der Schwerpunkt des Projekts miRs4Staph auf sogenannten microRNA(öffnet in neuem Fenster). MicroRNA sind eine gut erforschte Klasse kleiner, im Genom kodierter, nicht-kodierender RNA, die bei der Genexpression von Eukaryoten die post-transkriptionelle Regulierung übernehmen. „Neben vielen anderen Signalwegen sind diese microRNA wichtige Regulatoren des Zusammenspiels zwischen Wirt und Bakterium(öffnet in neuem Fenster)“, betont Projektkoordinatorin Ana Eulalio. Indem sie die Genexpression regulieren, können microRNA des Wirts auch verschiedene zelluläre Prozesse modulieren, die diese Interaktion stören. Allerdings wurde noch kaum untersucht, was mit der microRNA eines Wirtsorganismus passiert, wenn eine S. aureus-Infektion stattfindet.
Zur Rolle der microRNA bei einer S. aureus-Infektion
Unterstützt durch die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) führte das Projekt ein genomweites Screening von microRNA durch, die an einer S. aureus-Infektion beteiligt sind. Mittels Fluoreszenzmikroskopie wurde die Rolle von mehr als 2 000 menschlichen microRNA untersucht. Detailliert befasste man sich mit der Frage, welche Rolle spezifische microRNA während des Infektionsverlaufs spielen und welche einzelnen Stadien im S. aureus-Infektionszyklus (Invasion der Wirtszelle, Austritt ins Zytoplasma und/oder intrazelluläre bakterielle Replikation) von spezifischen microRNA gestört werden. „Das Projekt enthüllte erstmals detailliert den Beitrag von microRNA zur Interaktion zwischen S. aureus und Wirtszelle“, betont Marie-Skłodowska-Curie-Forschungsstipendiatin Laura Maria Alcantara. Insbesondere wurde eine Untergruppe von microRNA identifiziert, die den Verlauf einer S. aureus-Infektion deutlich beeinflusst. Damit könnten spezifischen microRNA infektionsfördernde oder -hemmende Eigenschaften zugeschrieben werden, die die intrazelluläre Replikation/Infektion verstärken bzw. behindern.
MicroRNA mit klinischer Relevanz
Weiterhin validierte miRs4Staph die identifizierten microRNA an einer Gruppe klinischer Isolate von S. aureus, die verschiedene klinische Manifestationen erbrachten (Knochen-/Gelenkinfektion, infektiöse Endokarditis und Bakteriämie). Dies belegt die klinische Relevanz der Forschungsarbeit und kann die Umsetzung der Projektergebnisse in klinische Anwendungen beschleunigen. Die Arbeitsgruppe will nun einige microRNA weiter untersuchen, um auf molekularer Ebene die direkten Zielstrukturen für einen Infektionsphänotyp zu finden. Bakterielle Resistenzen sind ein weltweit zunehmendes Problem in der Medizin, das neue Vorgehensweisen gegen Krankheitserreger erfordert, um steigender Morbidität und Mortalität zu begegnen. Das in miRs4Staph gewonnene Wissen zu Wirtsfaktoren, die den Verlauf einer S. aureus-Infektion beeinflussen, könnte neue therapeutische Ansätze aufzeigen und auch die Entwicklung infektionshemmender Strategien vereinfachen, die eher auf den Wirt abzielen als auf den hochgradig anpassungsfähigen Krankheitserreger.