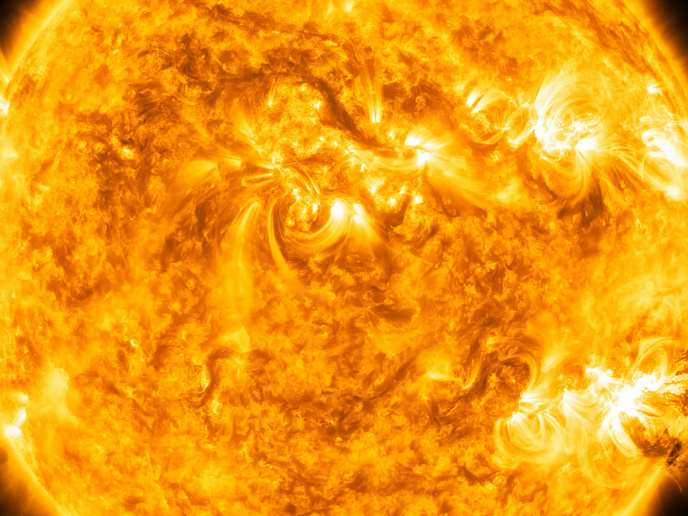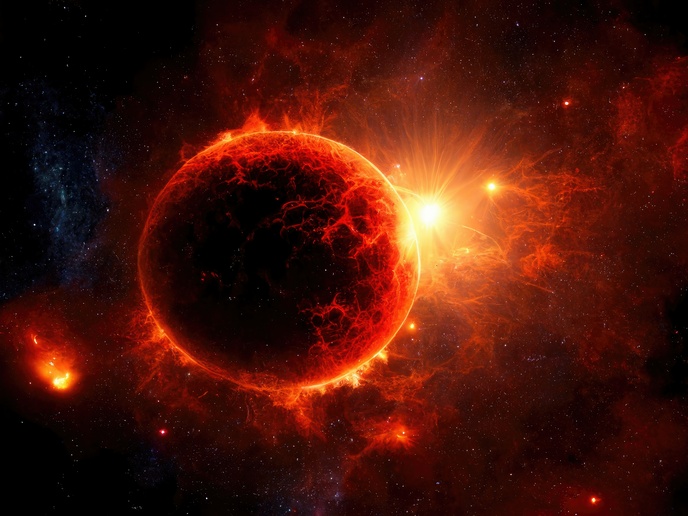Die Entstehung von Planeten aus einem anderen Blickwinkel betrachten
Das Observatorium Atacama Large Millimeter/submillimeter Array(öffnet in neuem Fenster) (ALMA) besteht aus 66 hochpräzisen Antennen und ist das größte Radioteleskop der Welt. ALMA ist nicht nur ein sehr großes Teleskop, sondern hat ebenso große Auswirkungen auf viele verschiedene Fachbereiche gehabt. Doch eines der Fachgebiete, das es am meisten verändert hat, ist die Planetenbildung. „Wir wissen, dass junge Sterne oft von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben sind, aus der sich Planeten bilden können“, sagt Til Birnstiel(öffnet in neuem Fenster), Professor für theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München(öffnet in neuem Fenster). „Mit ALMA können wir diese planetenbildenden Scheiben erstmals in hoher Auflösung sehen.“ Durch diese noch nie zuvor gesehenen Bilder von staubigen, planetenbildenden Ringen kamen jedoch neue Fragen auf. „Wir wollten wissen, ob Planeten die Ursache oder das Ergebnis dieser Strukturen sind“, fügt Birnstiel hinzu. Mit neuen Modellen bewaffnet und mit Unterstützung des EU-finanzierten Projekts DustPrints arbeitete Birnstiel daran, das Universum nach den Fingerabdrücken der Planetenbildung abzustauben.
Planetenbildung erfolgt schneller als bisher vermutet
Zu Projektbeginn herrschte allgemeiner Konsens darüber, dass die Planeten nicht die Ursache für diese Scheibenstrukturen sind. Das hat sich jetzt geändert. „Wir haben erstmals aufgezeigt, dass diese Strukturen allgegenwärtig sind, dass man immer dann, wenn man eine dieser Scheiben mit ausreichend hoher Auflösung beobachtet, auch eine Form von Substruktur sieht“, kommentiert Birnstiel. Mit einer neuen Methode zur Analyse dieser Beobachtungen konnten die Forschenden nachweisen, dass das Gas um diese Ringe genauso gestört ist wie um einen Planeten. Diese Hypothese wurde daraufhin durch das erste Bild eines Planeten im Inneren eines Planeten bewiesen. „Diese Ergebnisse zwangen die Fachwelt dazu, zu akzeptieren, dass Planeten die Hauptursache für diese Strukturen sind und dass die Planetenbildung schneller vonstatten gehen muss, als wir bisher für möglich hielten“, bemerkt Birnstiel.
Was kam zuerst, die Struktur oder der Planet?
Im Rahmen des vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) finanzierten Projekt wurde außerdem herausgefunden, dass die beobachteten Substrukturen alle den gleichen Grad an Transparenz aufweisen. Nach Angaben Birnstiel war dies merkwürdig, da die Bedingungen zwischen verschiedenen jungen Sternen unterschiedlich sein sollten. Wie sich herausstellte, war die Antwort auf dieses himmlische Rätsel die aktive Bildung von Objekten in Asteroidengröße. „Diese Erkenntnis unterstreicht das Henne-Ei-Problem bei der Planetenbildung“, so Birnstiel. „Planeten scheinen die Ursache für die meisten beobachteten Strukturen zu sein, aber die Strukturen scheinen die besten Orte zu sein, um diese Planeten schnell zu bilden.“ Die Forschenden bereiten sich darauf vor, Simulationen zu veröffentlichen, die verdeutlichen, wie Planeten nacheinander entstehen können, so wie ein Huhn Eier legt, aus denen neue Hühner schlüpfen.
Weitere Arbeit steht bevor
Das Team des Projekts DustPrints hat nicht nur belegt, dass Planeten viel schneller entstehen als bisher angenommen, sondern auch die Methoden erarbeitet, um zu demonstrieren, wie dieser Prozess abläuft. Einige dieser Instrumente wurden mit Preisen ausgezeichnet, viele davon sind bereits verfügbar und werden für weitere Forschungsarbeiten genutzt. Außerdem haben die Bilder von 20 jungen planetenbildenden Scheiben mit Substrukturen, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, Kultstatus erlangt und werden nun häufig in Vorträgen und Präsentationen verwendet. Es liegt somit noch einiges an Arbeit vor dem Team. „Wir müssen nachvollziehen, wie diese Planetenbildung in Gang kommt“, schließt Birnstiel. „Das bedeutet, dass wir die frühesten Stadien der Sternentstehung erforschen müssen, wenn die Scheibe gerade erst anfängt, sich zu bilden, um herauszufinden, ob diese ersten Stadien die Planetenentstehung beeinflussen – oder sogar auslösen – können.“ Birnstiel hat gerade einen ERC Consolidator Grant(öffnet in neuem Fenster) für genau diesen Zweck erhalten – also achten Sie auf diesen „Raum“!