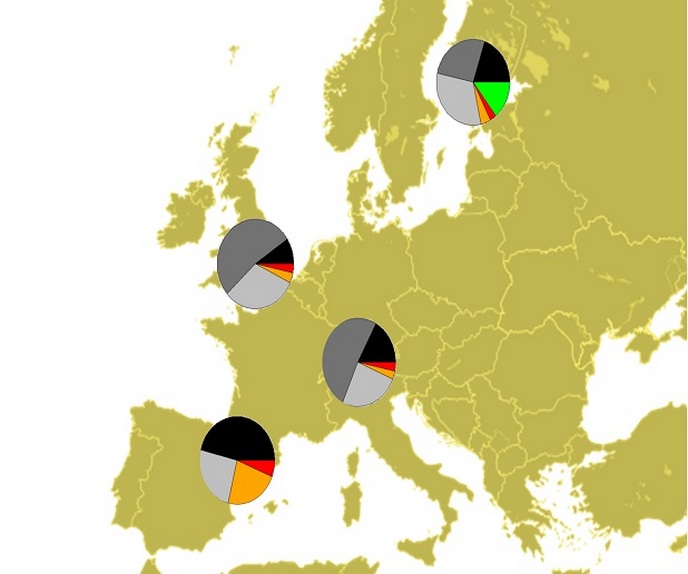Neue Erkenntnisse über Korallenfunktion dank Genomeditierung
Korallenriffe bilden das vielfältigste Ökosystem unseres Planeten und werden oft als die „Regenwälder des Ozeans“ bezeichnet. Die Erwärmung der Meerestemperaturen führt zu thermischem Stress, wodurch die Korallen vollständig weiß werden, d. h. erbleichen. Wenn sich die Bedingungen nicht verbessern, werden schätzungsweise 70 % bis 90 % dieser ökologisch wertvollen Meeresorganismen zu unseren Lebzeiten verschwinden. Mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) wurde im Rahmen des Projekts CORALCARE(öffnet in neuem Fenster) die Technologie CRISPR-Cas9(öffnet in neuem Fenster) eingesetzt, um zu erkunden, auf welche Weise genetische Signalwege an der Reaktion auf steigende Temperaturen beteiligt sind.
Korallenlaich und Versuchsaufbau
Genetik auf Korallen anzuwenden, bringt mehrere Herausforderungen mit sich. Die Forschenden müssen CRISPR-Cas9 unter einem Mikroskop in befruchtete Eizellen injizieren, was ein physisch anspruchsvoller Prozess ist. Da Korallenarten nur einmal im Jahr laichen, steht dem wissenschaftlichen Personal nur ein begrenztes Zeitfenster zum Handeln zur Verfügung. Das Projekt CORALCARE war eine Zusammenarbeit zwischen der gemeinsamen französischen Forschungseinheit für tropische Meeresökologie des Pazifischen und Indischen Ozeans ENTROPIE(öffnet in neuem Fenster) und dem Australischen Institut für Meereswissenschaften(öffnet in neuem Fenster) (AIMS). Die Experimente wurden in der AIMS-Anlage durchgeführt, in der Becken erwachsene Korallenkolonien beherbergen und ein Labor mit einem Mikroinjektionsgerät und einem Fluoreszenzstereoskop für die Forschung bereitsteht. Als die Korallen über einen Zeitraum von neun Tagen laichten und mehrere hundert Eier pro Nacht freisetzten, wurde einem Teil des Laichs CRISPR-Cas9-Moleküle injiziert, um das Sacsin-Gen zu editieren. Die verbleibenden Eizellen wurden in zwei Kontrollgruppen aufgeteilt: Einer Gruppe wurden CRISPR-Reagenzien injiziert, jedoch ohne die Fähigkeit zur Genomeditierung, und der weiteren Gruppe wurde gar nichts injiziert. Die Eier in der Studie wurden als Larven aufgezogen, und wenn sie das Schwimmstadium erreichten, wurden sie mit Wärmestress verbundenen Bedingungen ausgesetzt. Vier Tage lang wurde die Hälfte jeder Kohorte einer Temperatur von 34 ℃ ausgesetzt, während die übrige Hälfte ihr Leben bei der Rifftemperatur von 27 ℃ verbrachte. Da die meisten Korallenarten im Sommer laichen, waren die Forschungsanlagen am AIMS sehr gefragt. Dem CORALCARE-Team gelang jedoch ein Durchbruch mit einer im Herbst laichenden Art. Marie-Skłodowska-Curie-Stipendiatin Severine Fourdrilis erklärt dazu: „Erstmalig konnten wir Acropora subabrolhosensis in Gefangenschaft im Herbst erfolgreich zum Laichen bringen und ihre Laichzeiten dokumentieren. Dadurch steht eine zusätzliche Art und eine zusätzliche Laichzeit für die Genomeditierung zu Verfügung, was die Forschungsarbeit beschleunigt.“
Gezielte Gene und die Zukunft der chemischen Editierung
Das CORALCARE-Team sprach per Mikroinjektion gezielt das Sacsin-Gen an, um unser Verständnis für dieses Gen zu vertiefen. Die Experimente ergaben, dass das Gen bei der Koralle Acropora loripes eine schützende Rolle bei Wärmestress spielt. „Sacsin-editierte Larven, die die Funktion des Sacsin-Gens verloren hatten, wiesen unter Hitzestress eine höhere Sterblichkeit auf. Diese Ergebnisse belegen die Funktion von mindestens einem Sacsin-Gen in Bezug auf die Wärmetoleranz der Korallenlarve“, erläutert Fourdrilis. Während die Mikroinjektion ein schwieriges Genomeditierungsverfahren ist, haben die Fortschritte bei der Transfektion oder der chemischen Injektion einen effizienteren Ansatz zu bieten. Fourdrilis dazu: „Im Rahmen des Projekts wurden vielversprechende Chemikalien für die CRISPR-Transfektion ermittelt und erprobt. Es wurde ein Transporter identifiziert, der CRISPR-Moleküle erfolgreich zu Koralleneiern transportiert.“ Durch Transfektion können mehrere Gene gleichzeitig editiert werden, wodurch sich die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Forschung rasch erweitern. Diese Entwicklung kommt keinen Moment zu früh, denn ein tieferes Verständnis der Korallengenetik ist notwendig, wenn wir die Riffe der Welt für die kommenden Generationen schützen wollen. Assistierte Evolution kann Korallenarten retten, aber zuerst müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre genetischen Funktionen noch besser verstehen.