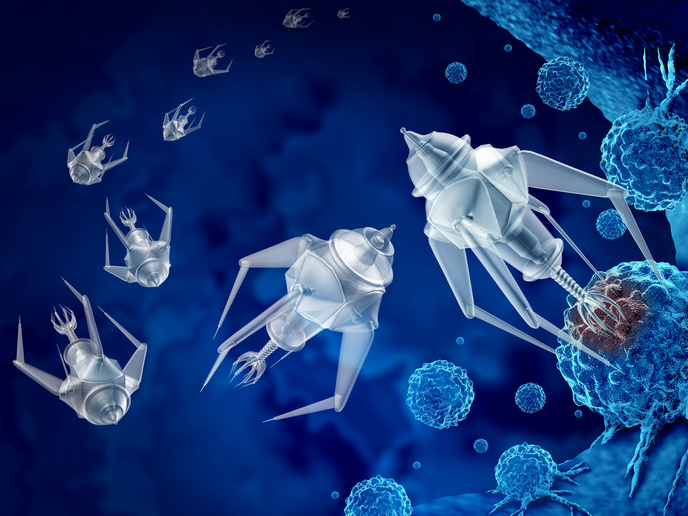Exposition des Menschen gegenüber Nanokunststoffen abschätzen
Nanokunststoffe, extrem kleine Kunststoffteile oder -partikel, die in die Umwelt gelangen können, bilden den Mittelpunkt zahlreicher akademischer Forschungsarbeiten. Ein Großteil dieser Arbeiten konzentrierte sich jedoch eher auf ihre potenziellen Auswirkungen auf die Ökosysteme als auf die Gefahren, die sie für die menschliche Gesundheit darstellen. Das EU-finanzierte Projekt PLASTICHEAL(öffnet in neuem Fenster) wurde ins Leben gerufen, um dieses Missverhältnis zu beheben. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, besser zu verstehen, was in uns vorgeht“, erklärt PLASTICHEAL-Projektkoordinatorin Alba Hernández von der Autonomen Universität Barcelona(öffnet in neuem Fenster) (UAB) in Spanien.
Verfahren zur Identifizierung von Nanopartikeln beim Menschen
Mit der Projektarbeit wurden zwei verschiedene Ziele verfolgt. Das erste Ziel lautete, ein klareres Bild des Ausmaßes der Exposition des Menschen gegenüber Nanokunststoffen zu erhalten, worin ein wichtiger erster Schritt zum Verständnis der Größe des Problems besteht. Zweitens ging es darum, die potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen, die bestimmte Expositionswerte auslösen können, besser zu verstehen. Hernández merkt an, dass bei der Bewertung des Ausmaßes der Exposition des Menschen die Größe der Nanopartikel entscheidend sei. „Es sind nur die kleineren Nanokunststoffe, die aus der Luft oder der Nahrung in den Körper und in den Blutkreislauf gelangen können“, stellt sie klar. „Von dort aus können sie sich verteilen und in den Organen ansammeln.“ Es wurden neue Technologien entwickelt, um diese Nanokunststoffe in Lebensmitteln und Getränken sowie in der Luft zu erkennen und sie in Blut und Urin nachzuweisen. Die Beschäftigten der Kunststoffindustrie wurden Tests unterzogen, da davon auszugehen war, dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit Nanokunststoffen ausgesetzt gewesen sind. „Niemand zuvor war wirklich in der Lage, dies für Kunststoffpartikel mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer zu realisieren“, fügt Hernández hinzu. „Das hat uns geholfen, die Konzentrationsverhältnisse innerhalb des Körpers besser zu verstehen.“
Mögliche Auswirkungen von Nanokunststoffen im Körper
Im nächsten Schritt wurden In-vitro-Instrumente entwickelt, um die möglichen Auswirkungen von Nanokunststoffen im Körper zu untersuchen. „Wir wollten sehen, was geschieht, wenn Kunststoffe in die Zellen eindringen, und ob dies zu Stress, Veränderungen der DNS oder Entzündungsreaktionen usw. führt“, erklärt Hernández. „Außerdem wollten wir wissen, ob wir langfristige Auswirkungen einschließlich Karzinogenität vorhersagen und etwaige Veränderungen im Mikrobiom bewerten können.“ Zu diesem Zweck wurden im Rahmen des Projekts Nanopartikel entwickelt, die den in der Natur vorkommenden so weit wie möglich entsprechen. Damit sollte sichergestellt werden, dass jegliche Ergebnisse so genau wie möglich ausfallen. „Wir sind zu Informationen gelangt, die unserer Meinung nach ausreichend Grund zur Sorge geben“, berichtet Hernández. „Es gibt jedoch noch viel mehr zu verstehen, und wir wissen immer noch nicht, wie hoch sichere Grenzwerte sein könnten.“
Entwicklung und Harmonisierung von Analysetechnologien
Das Konsortium bereitet gegenwärtig einen neuen Vorschlag vor, der diese Arbeit auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und der entwickelten Technologien fortsetzen soll. „Wir wissen jetzt viel mehr als früher“, sagt Hernández. Zu den nächsten Schritten gehört die Weiterentwicklung und Harmonisierung der Analysetechnologien. „Diese müssen nicht nur innerhalb unserer Projektgruppe, sondern für die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft nutzbar sein“, fügt Hernández hinzu. „Wir müssen verschiedene Protokolle mit den Normungsgremien diskutieren.“ Während der Projektarbeit wurden große Anstrengungen unternommen, um die Industrie und die Aufsichtsbehörden einzubeziehen und sicherzustellen, dass die gesammelten Daten für die Gesellschaft so nützlich wie möglich sein werden. Letztendlich, betont Hernández, soll das Ganze dazu beitragen, das Risiko genau zu bewerten und sichere Grenzwerte festzulegen.