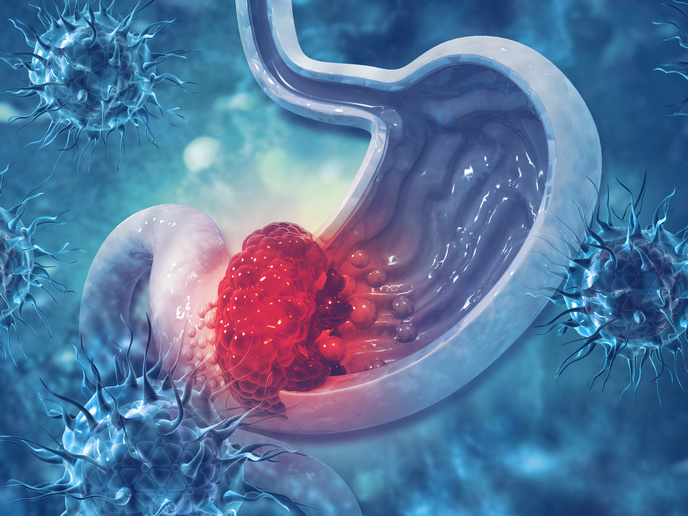KI-basierte Klinikfachkraft unterstützt Magenkrebsbehandlung
Ein internationales Forschungsteam hat eine auf verstärkendem Lernen basierende KI-gestützte Diagnoseassistenz entwickelt, dank der eine Behandlung gegen Helicobacter pylori, ein weltweit als Hauptursache für Magenkrebs geltendes Bakterium, maßgeschneidert angepasst werden kann. Das Vorhaben erhält Unterstützung durch das EU-finanzierte Projekt AIDA(öffnet in neuem Fenster) sowie das im Rahmen des Programms EU4Health(öffnet in neuem Fenster) finanzierten Projekts TOGAS. Mit dem System wird das Potenzial von KI zur Hilfestellung bei der klinischen Entscheidungsfindung sowie zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei von Magenkrebs Betroffenen demonstriert. Die überwiegende Mehrheit der Magenkrebsfälle ist auf eine Infektion mit H. pylori zurückzuführen. Es wird angenommen, dass sich diese Art von Krebs nach jahrelanger gastrischer Atrophie entwickelt, einer Erkrankung, bei der die Magenschleimhaut dünner wird und die die Verdauung unterstützenden Drüsenzellen verloren gehen. Dieser Verlust bildet einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Magenkrebs. Da davon auszugehen ist, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwann im Lauf ihres Lebens von einer H. pylori-Infektion betroffen sein wird, ist es offensichtlich, dass die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) genutzt werden müssen, um den Umgang damit und die Behandlung zu bewerten und zu verbessern. Denn ungeachtet aller aktuellen Fortschritte bei der Behandlung im Zusammenhang mit Chemotherapie und Chirurgie weist Magenkrebs im Vergleich zu anderen Krebsarten immer noch, vor allem im fortgeschrittenen Stadium, eine schlechte Prognose auf. Diese KI-Klinikfachkraft verfügt über das Potenzial, hier Veränderungen herbeizuführen. Durch Optimierung von Therapien zur frühzeitigen Eradikation des H. pylori-Bakteriums kann sie die Krebsprävention weltweit erheblich voranbringen.
Durch Versuch und Irrtum lernen
Das System gibt patientenspezifische Empfehlungen für die Erstbehandlung und ermittelt, ob derartige KI-gesteuerte personalisierte Behandlungen die Eradikationsrate der Erkrankung im Vergleich zu den ärztlich verordneten Therapien verbessern würden. Zu diesem Zweck wird ein Ansatz des maschinellen Lernens, das sogenannte „verstärkende Lernen“, eingesetzt, bei dem durch Versuch und Irrtum gelernt wird, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Nutzen in einem bestimmten Zustand zu maximieren. Das Modell wurde an über 38 000 Patientinnen und Patienten aus dem European Registry on the Management of Helicobacter pylori Infection trainiert und intern validiert. Dabei handelt es sich um eine Datenbank, in der systematisch Daten aus der klinischen Routinepraxis in Europa über die Behandlung von H. pylori-Infektionen gesammelt werden. Unter Einsatz von tiefem Q-Lernen-Verfahren mit unabhängigen Zuständen werden die wirksamsten Therapien auf der Grundlage von Patientenmerkmalen wie Alter, Geschlecht, Land, Antibiotikaallergien, Symptomen und anderen gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln empfohlen.
Gemeinsam stärker sein
Wie in der in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlichten Studie(öffnet in neuem Fenster) beschrieben wird, verbesserte das System den Behandlungserfolg um 6 %. Bei den von der KI empfohlenen Therapien wurde eine Erfolgsquote von 94,1 % festgestellt, während die ärztlich verordneten, nicht mit den KI-Vorschlägen abgestimmten Therapien eine Erfolgsquote von 88,1 % aufwiesen. Wie das Forschungsteam in seiner Studie hervorhebt, ist die KI-Klinikfachkraft für den Einsatz an der Seite des klinischen ärztlichen Personals gedacht. Es gehe nicht darum, die Überlegenheit der KI gegenüber der klinischen Entscheidungsfindung vorzuführen, sondern darum aufzuzeigen, wie Empfehlungen mithilfe der KI-Assistenz verbessert werden könnten. „Diese Studie zeigt, wie KI reale klinische Daten nutzen kann, um retrospektiv Strategien zur Helicobacter-pylori-Eradikation zu optimieren, und somit den Weg in ein neues Zeitalter der datengesteuerten Präzisionsmedizin bereitet“, bekräftigt Studien-Koautor Kirill Veselkov vom AIDA-Projektpartner Imperial College London, in einer Pressemeldung(öffnet in neuem Fenster), die auf der Nachrichtenseite der Universität veröffentlicht wurde. Im Dezember 2026 endet das Projekt AIDA (An Artificially Intelligent Diagnostic Assistant for gastric inflammation). Weitere Informationen: AIDA-Projektwebsite(öffnet in neuem Fenster)