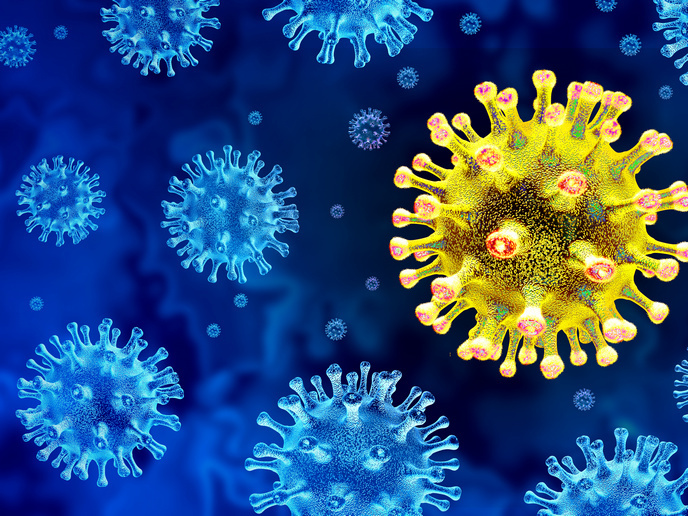Eine Chemikalienexposition väterlicherseits kann Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes haben
Während die Auswirkungen des mütterlichen Lebensstils und Expositionen im Mutterleib gut untersucht sind, blieb die epigenetische Vererbung väterlicherseits weitgehend unberücksichtigt. Neue Forschungsergebnisse des EU-finanzierten Projekts PATER deuten jedoch darauf hin, dass auch die Umwelt väterlicherseits einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit des Kindes haben kann. „Wenn ein Spermium eine Eizelle befruchtet, wird nicht nur DNS übertragen, sondern auch die Auswirkungen der Exposition gegenüber verschiedenen Umweltfaktoren – darunter Chemikalien, Stress und Lebensstilentscheidungen – werden an nachfolgende Generationen weitergegeben“, sagt Oskar Karlsson, Forschungsleiter am SciLifeLab, Fachbereich für Umweltwissenschaft, Universität Stockholm(öffnet in neuem Fenster), dem koordinierenden Partner des Projekts. Diese Erkenntnis ist besonders bedenklich, wenn man berücksichtigt, dass der Einsatz von Chemikalien in den vergangenen Jahren dramatisch angestiegen ist. Deshalb konzentrierte sich das PATER-Projekt speziell darauf, wie die Exposition väterlicherseits durch epigenetische Vererbung gegenüber antiandrogenen Schadstoffen die Gesundheit der Nachkommen beeinflussen kann. Antiandrogene Schadstoffe sind in der Umwelt vorkommende Chemikalien, die die männlichen Sexualhormone des Körpers durch Blockierung des Androgenrezeptors stören. Die epigenetische Vererbung beschreibt, wie erworbene Merkmale, die durch Umweltfaktoren beeinflusst werden, über Generationen weitergegeben werden können, ohne die zugrunde liegende DNS-Sequenz zu verändern.
Konkrete Beweise für die epigenetische Vererbung väterlicherseits
Das mit Unterstützung des Europäischen Forschungsrats(öffnet in neuem Fenster) durchgeführte Projekt kombinierte unter Verwendung von Frosch- und Mausmodellen verschiedene Ansätze, einschließlich molekularer, toxikologischer und epigenomischer Tests. Dabei wurden konkrete Beweise für die epigenetische Vererbung väterlicherseits bei Wirbeltieren entdeckt. „Unsere Forschung zeigt, dass die Exposition des Vaters gegenüber Chemikalien tatsächlich die epigenetischen Merkmale eines Spermiums verändern und dadurch gesundheitliche Auswirkungen bei den Nachkommen und sogar Enkelkindern hervorrufen kann“, erklärt Karlsson. Forschende konnten bei Fröschen nachweisen, dass der Kontakt mit Pestiziden die Fruchtbarkeit verringern und über Generationen hinweg zu einer Stoffwechseländerung führen kann. Anhand der Mäuse wurde beleuchtet, wie die Exposition gegenüber einem gängigen Weichmacher zu Stoffwechsel- und Immunstörungen führt, die auch bei nicht exponierten Nachkommen fortbestehen. Das Projekt deckte auch verschiedene der molekularen Mechanismen auf, die diesen Effekten zugrunde liegen, darunter zum Beispiel Veränderungen in den Spermienbiomolekülen, die mit der Exposition des Vaters mit vererbbaren Folgen für die Nachkommen in Verbindung stehen.
Die Wissenschaft, Geschlechtergleichstellung und soziale Gerechtigkeit voranbringen
Laut Karlsson tragen diese Erkenntnisse dazu bei, eine fundierte und neue Diskussionen über die Fortpflanzungsgesundheit in der Wissenschaft und Politik in Gang zu bringen. „Da das Projekt die langfristigen Folgen hervorhebt, die die Exposition des Vaters für die Gesundheit seiner Nachkommen haben kann, stellt es das traditionelle Narrativ in Frage, dass nur Mütter für die Gesundheit ihrer Kinder verantwortlich sind“, fügt er hinzu. „Damit leistet PATER nicht nur einen Beitrag zur Wissenschaft, sondern hilft auch, die Gleichstellung der Geschlechter und die soziale Gerechtigkeit voranzubringen.“ Das Projekt unterstreicht die Notwendigkeit von generationenübergreifenden Toxizitätstests und die Bedeutung der Sensibilisierung von Männern im Bereich der pränatalen Gesundheit, während gleichzeitig die Ziele der EU in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Chemikaliensicherheit und Umweltschutz unterstützt werden. Ein wichtiger Erfolg des Projekts war beispielsweise die starke Miteinbeziehung der Öffentlichkeit und politischer Entscheidungsbefugter – diese Miteinbeziehung hat dazu beigetragen, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in verständliche Botschaften darüber zu übersetzen, wie sich die Umwelt väterlicherseits Vaters direkt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder und Kindeskinder auswirken kann. „Wir hoffen, dass dieser Dialog weiterhin eine Inspiration für die Sensibilisierung und Maßnahmen ist, und so zu gerechteren Diskussionen über die Fortpflanzungsgesundheit und einem besseren Schutz vor Umweltschadstoffen beiträgt“, lautet das Fazit von Karlsson. Während die Ergebnisse von PATER stets schon vor der Veröffentlichung offen mitgeteilt wurden, um den Fortschritt in diesem aufstrebenden Gebiet zu beflügeln, finalisiert das Forschungsteam nun mehrere hochkarätige Publikationen, die auf den neuesten Daten des Projekts basieren.