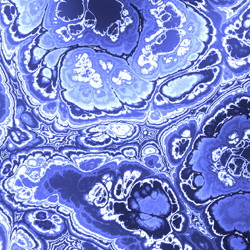Kräfte zwischen Zellen
Die Kommunikation und Weiterleitung von Signalen zwischen Zellen wird in fast allen Geweben über Zell-Zell-Kanäle realisiert. Dabei handelt es sich um paarweise angeordnete Halbkanäle oder Connexone, die jeweils aus einem Ensemble von sechs Proteinen (Connexine) bestehen. Obwohl Funktion und chemische Zusammensetzung der Gap Junctions gut beschrieben sind, ist wenig bekannt über die Kräfte und Energien, die bei solchen Kontakten wirken. Das EU-finanzierte Projekt GAPJUNCTION STRENGTH ("Biophysical determinants of the adhesion strength of gap junctions") untersuchte mit hochmodernen nanotechnologischen Methoden und Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy, AFM) kinetische Eigenschaften und Bindungsstärke zwischen Zell-Zell-Kanälen. Mithilfe aufgereinigter Connexine in rekonstruierten Lipidmembranen wurden biophysische Daten über diese interzellulären Bindungen ermittelt. Die Projektforscher legten Kräfte an interagierende Proteinmoleküle an und ermittelten die Dissoziationseigenschaften. Eine schnelle Dissoziation deutete auf eine dynamische Bindung hin, eine langsame Dissoziation auf verminderte Flexibilität. Auch die extrazellulären Loops, die für diese Untersuchungen konstruiert worden waren, waren kleiner. Die Adhäsionskraft war signifikant, daher kann die Bindung offenbar beträchtliche Krafteinwirkung tolerieren, bevor sie dissoziiert. Die Ergebnisse des Projekts wurden in Fachzeitschriften veröffentlicht - im Journal of Molecular Biology beispielsweise erschien ein Beitrag zur Beschaffenheit der Bindungen. Eine noch unveröffentlichte Publikation behandelt eine neue AFM-Bildgebungsmethode, mit der sich mechanische Eigenschaften von Membranproteinen in submolekularer Auflösung darstellen lassen. Die biophysikalische Charakterisierung von Protein-Protein-Bindungen an Gap Junctions soll Aufschluss über die Eigenschaften interzellulärer Kanäle liefern. Da die Funktion der Gap Junctions die strukturelle und biochemische Integrität vielzelliger Organismen entscheidend beeinflusst, könnten auf dieser Basis neue molekulare Therapien gegen ähnliche Erkrankungen entwickelt werden.