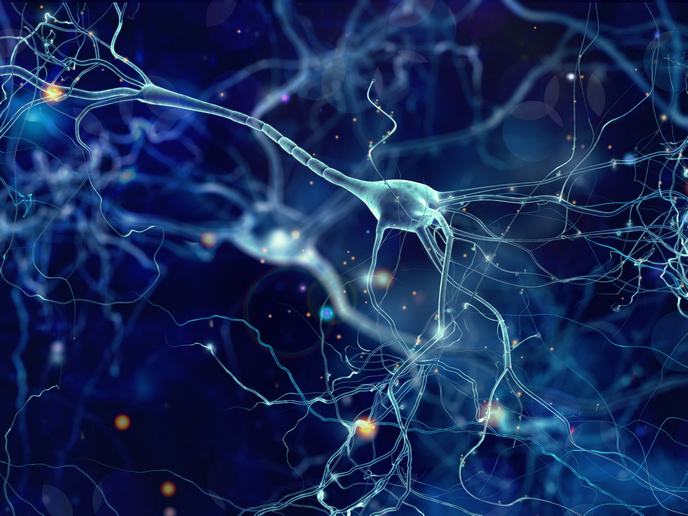Ein tieferes Verständnis der Darm-Hirn-Achse
Die intestinale Mikrobiota, die gängiger unter dem Begriff Mikroflora bekannt ist, ist ein komplexes Ökosystem von Mikroorganismen, – im Wesentlichen Bakterien – die den Darm besiedeln und in Symbiose mit unserem Körper leben. Um die Verbindung zwischen Gehirn und Mikrobiom näher zu beleuchten, betrachtete die leitende Forscherin des GaMePLAY-Projekts Paola Tognini, wie die Mikroflora im Darm die Entwicklung und Plastizität des Gehirns moduliert. Ausgehend von der Scuola Normale Superiore(öffnet in neuem Fenster) in Pisa nutzte sie eine bewährte Methode für die Beurteilung der Entwicklung des visuellen Kortex bei Mäusen. Die Neuro- oder Gehirnplastiztität ist die Fähigkeit unseres Hirns, seine Schaltkreise in Reaktion auf externe Reize und/oder Erlebnisse zu verändern. Tognini fokussierte sich auf die Plastizität des adulten Gehirns. Die Eigenschaft der „Veränderlichkeit“ ist vor allem bei den jungen Gehirnen ausgeprägt und nimmt mit dem Alter ab. Tognini erklärt dazu: „Unser Gehirn enthält Areale, die nur in bestimmten Zeitfenstern der postnatalen Entwicklung eine Plastizität zeigen. Wenn diese besondere Zeit der Jugend vorbei ist, werden die Schaltkreise stabil und sind nicht mehr wandelbar.“ Das GaMePLAY-Projekt, das durch das Marie-Skłodowska-Curie-Programm unterstützt wurde, stellte die Frage, ob Signale, die aus der intestinalen Mikrobiota ausgehen, die erneute Aktivierung der Plastizität im Gehirn adulter Mäuse begünstigen könnten. „Um dieses Ziel zu erreichen, verwendete ich das visuelle System als Modell, da adulte Tiere normalerweise keine Plastizität zeigen. Wichtig war meine Beobachtung, dass spezifische Änderungen in der Zusammensetzung der Darmmikroben tatsächlich die Plastizität im visuellen Areal des Gehirns adulter Mäuse fördern können. Die Gehirne dieser Tiere verhielten sich wie das Gehirn einer jungen Maus, das sich in Reaktion auf spezifische Reize verändert“, merkte Tognini an.
Die Bedeutung ausgestalteter Käfige für die Mikrobiota von Mäusen
GaMePLAY stellte fest, dass sich die Zusammensetzung der Mikroflora im Darm mit dem Alter der Tiere und auch mit der Art der Umgebung, in welcher die Mäuse gezüchtet wurden, veränderte. „Mäuse, die in Umgebungen leben, welche die Gehirnplastizität fördern können, (ich würde dies als ,Pro-Plastizität‘ bezeichnen), enthalten unterschiedliche Mikroben im Vergleich zu Mäusen, die in einer nicht stimulierenden Umgebung leben“, sagt Tognini. Dieselben Tiere wurden in verschiedenen Lebensphasen analysiert: vor der Entwöhnung, als entwöhnte Jungtiere und im Erwachsenenalter. Interessanterweise blieben die größten Unterschiede in der bakteriellen Zusammensetzung im Erwachsenenalter. „Ich denke, dies muss der Tatsache zugrunde liegen, dass die adulten Mäuse die Vielzahl der Reize, die ihnen in den Käfigen präsentiert werden, umfassend und besser erleben können“, erklärt Tognini. Zur Beurteilung der Gehirnplastizität zeichnete die Forscherin die Reaktionen von Neuronen im visuellen Kortex auf, die zum okzipitalen Teil des Gehirns gehören. Sie untersuchte insbesondere die Plastizität der okularen Dominanz. Die okulare Dominanz steht für die Eigenschaft von Neuronen des visuellen Kortex, bevorzugt auf die Sehsignale eines Auges im Vergleich zu dem anderen Auge zu reagieren. Bei der jungen Maus ist es möglich, ein plastisches Phänomen zu induzieren, das einem Wechsel der neuronalen Präferenz in Bezug auf das Sehsignal von einem Auge im Vergleich zu dem anderen Auge entspricht. Dieses plastische Phänomen ist bei der adulten Maus nicht vorhanden, sofern diese nicht unter speziellen Umgebungsbedingungen gezüchtet wird. „In unserer Studie fanden wir heraus, dass die Aufzucht der Mäuse in einer stimulierenden, ,speziellen Umgebung‘ die Plastizität der okularen Dominanz fördert und dass die Darmbakterien zu diesem Pro-Plastizitätseffekt beitragen“, erklärt Tognini. GaMePLAY vermochte es, durch die Manipulation von Darmmikroben die Möglichkeit einer Reaktivierung der Gehirnplastizität zu demonstrieren. Die Implikationen dieses Konzepts reichen weit und sind nicht auf die Sinnessysteme und den visuellen Kortex beschränkt. „In der Tat präpariere ich jetzt die spezifischen Bakterien und die von ihnen abgeleiteten Moleküle, um neuartige Probiotika und Präbiotika zu identifizieren. Im Moment übertrage ich diese Informationen auf vorklinische Krankheitsmodelle, die durch Plastizitätsdefekte charakterisiert sind. Ich fokussiere mich jetzt insbesondere auf neurologische Entwicklungsstörungen, um zukünftige Therapien für deren Behandlung zu entdecken“, lautet das Fazit von Tognini.