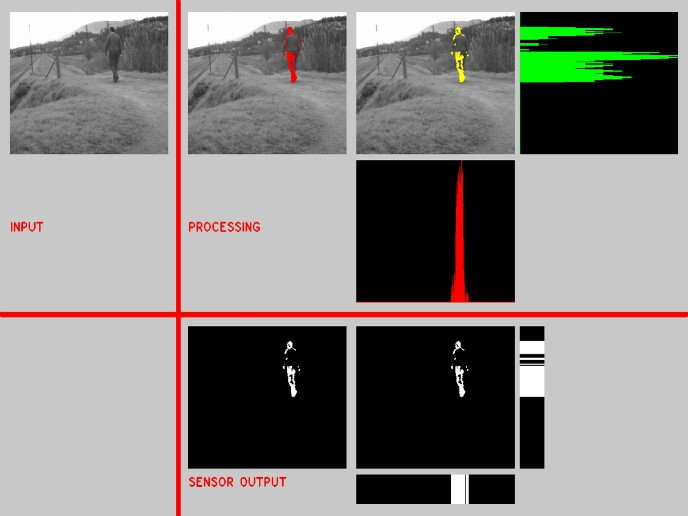Verknüpfung sozialer und kognitiver Netzwerke in der Adoleszenz
Soziale Bindungen bilden bei vielen Arten das Grundgerüst der Interaktion und waren im Verlauf der Evolution der Schlüssel zum Überleben der Menschen, da sie Sicherheit, Unterstützung und Geborgenheit bedeuten. Während die Sozialwissenschaft die Struktur der komplizierten sozialen Netzwerke der modernen Gesellschaft untersucht, erforscht die Neurowissenschaft jene Gehirnmechanismen, mit denen wir in ihnen navigieren können. Diese Forschungslinien verlaufen jedoch weitgehend getrennt, was Erklärungen unvollständig bleiben lässt. Per Neuroimaging(öffnet in neuem Fenster) wurden in streng kontrollierten Labors Beweise dafür gefunden, dass positive soziale Interaktionen die gleichen Belohnungsnetzwerke im Gehirn aktivieren, wie sie auch durch angenehme Erfahrungen wie Essen und Sex ausgelöst werden.
Eine Schlüsselphase der Entwicklung
„Während wir hier Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns erhalten, ist das Sozialverhalten außerhalb des Magnetresonanztomografen dynamisch; Individuen sind nicht passiv, sondern interagieren in vielfältigen und veränderlichen Situationen. Hier liegt das Reich der Sozialwissenschaften“, erklärt Lydia Krabbendam(öffnet in neuem Fenster) von der Vrije Universiteit Amsterdam(öffnet in neuem Fenster), an der das Projekt beheimatet ist. Das vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) finanzierte Projekt SCANS konzentrierte sich auf die sozialen Bindungen, die in der Adoleszenz als einer Schlüsselphase der Entwicklung für das spätere Sozialverhalten entstehen. SCANS fand heraus, dass die Position eines Individuums in den sozialen Netzwerken des Klassenzimmers mit dem Grad des sozialen Vertrauens und der Aktivität im Belohnungsnetzwerk des Gehirns korreliert.
Ab ins Klassenzimmer
Die Adoleszenz ist eine zentral wichtige Entwicklungsphase, die durch eine erhöhte Sensibilität für Prozesse innerhalb von Gleichaltrigengruppen gekennzeichnet ist. Ergebnis ist eine soziale Neuorientierung, bei der sich die sozialen Netzwerke ausdehnen und immer komplexer werden – und diese Prozesse gehen mit der Reifung der sozialen kognitiven Funktionen einher. „Auch psychopathologische Befunde(öffnet in neuem Fenster) wie Depressionen oder soziale Ängste manifestieren sich oft erstmals in der Adoleszenz, was mit der erhöhten Bedeutung der sozialen Interaktionen zusammenhängen könnte“, ergänzt Krabbendam. Neben dem neuropsychologischen Hintergrund der Projektkoordinatorin Krabbendam umfasste der Forschungsansatz von SCANS gleichermaßen die Bereiche Anthropologie, Wirtschaftswissenschaft und Soziologie. SCANS führte Analysen sozialer Netzwerke durch, bei denen die Beziehungen zwischen den Individuen in einer Gruppe, in diesem Fall im Klassenraum, mithilfe von Fragebögen erkundet werden. SCANS bat zum Beispiel jede einzelne Person, alle Menschen, mit denen sie befreundet ist oder die sie mag, aufzulisten. Daraus ergab sich ein Netzwerk aus Verbindungen (Beziehungen) und Knoten (Individuen), auf dessen Grundlage verschiedene Einzel- und Gruppenanalysen durchgeführt werden konnten. Ermittelt wurde etwa, wie zentral eine Person in einem Netzwerk oder wie dicht ein Gruppennetzwerk ist. Diese Ergebnisse wurden dann in Bezug auf andere Messgrößen statistisch analysiert. Beispielsweise dienten sozial-kognitive Aufgaben der Bewertung des Vertrauens und der Fähigkeit, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen. Außerdem kamen Fragebögen mit Selbstauskünften zum Einsatz, um mögliche psychische Störungen wie etwa Depressionen zu bewerten.
Von Bindungen und Hirnen
SCANS warb insgesamt 900 Jugendliche aus mehr als 40 Schulklassen an und bewirkte, dass sie drei Jahre lang zweimal jährlich an der Studie teilnahmen, wobei in der Hälfte der Fälle die gesamte Klasse einbezogen wurde. Als ein besonders bemerkenswertes Ergebnis galt, dass die Längsschnittdaten sowohl aus den Fragebögen als auch aus den Aufgaben auf eine kontinuierliche Entwicklung der sozialen Kognition zwischen 12 und 15 Jahren hindeuteten, wobei es einige interessante Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gibt. „Es herrscht die Meinung vor, dass die Mädchen in sozialer Kognition besser sind. Wir fanden heraus, dass das für einige Aspekte tatsächlich zutrifft – sie zeigten mehr Empathie und eine bessere Fähigkeit zur Perspektivübernahme – aber nicht für andere; Jungen zeigten zum Beispiel mehr Vertrauen“, erklärt Krabbendam. Ein weiteres wichtiges Ergebnis war, dass Personen, die zentraler im sozialen Netzwerk agieren, also mehr wechselseitige Freundschaften mit anderen zentralen Personen pflegen, ein höheres Maß an Vertrauen zeigten, wobei die Belohnungsnetzwerke im Gehirn bei Vertrauensentscheidungen aktiver waren. „Wir können zwar keine Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung ziehen, aber die Untersuchung hebt deutliche Zusammenhänge zwischen sozialem Kontext und sozialem Gehirn hervor und lässt dabei viel Spielraum für die zukünftige innovative multidisziplinäre Forschung“, berichtet Krabbendam abschließend.