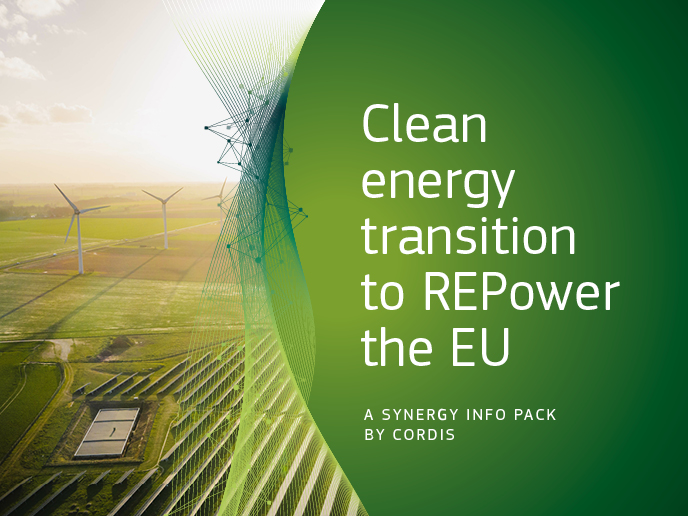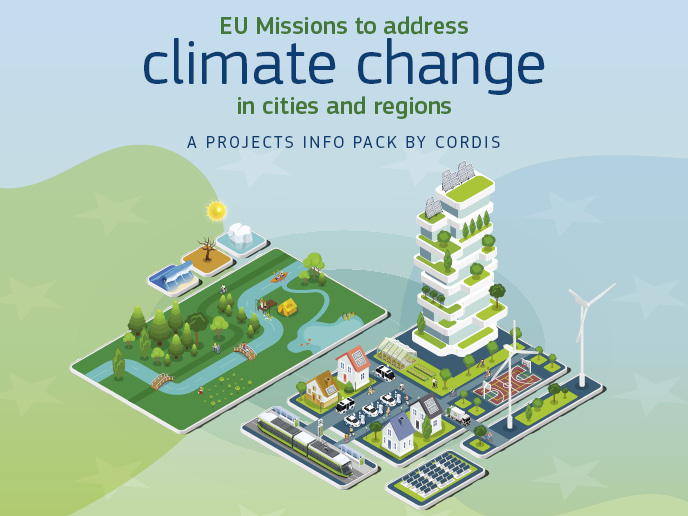Temperaturanstieg im Zusammenhang mit CO2-Emissionen aus Gestein
Die Temperatur der Erdoberfläche wird durch die Konzentration von Gasen wie CO2 in der Atmosphäre beeinflusst, die zum sogenannten Treibhauseffekt beitragen. Seit der industriellen Revolution ist die CO2-Konzentration vor allem aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe beträchtlich angestiegen. Die Bekämpfung dieser Emissionen ist entscheidend für die Eindämmung des Temperaturanstiegs. Zur Abbildung der erzielten Fortschritte müssen die CO2-Emissionen genau gemessen und die Quellen der Verlagerung von CO2-Emissionen ermittelt werden. Das bedeutet, dass nicht nur die vom Menschen verursachten Emissionen, sondern auch die natürlichen Ursachen für die Verlagerung von CO2-Emissionen berücksichtigt werden müssen.
Natürlicher Kohlenstoffkreislauf
Das Projekt ROC-CO2(öffnet in neuem Fenster) wurde gestartet, um eine Lücke in unserem Verständnis des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs zu schließen. In der Wissenschaft ist bekannt, dass bei der Zersetzung von Gestein CO2 sowohl freigesetzt als auch absorbiert werden kann. Das ist zum Teil auf die Oxidation des darin enthaltenen organischen Kohlenstoffs zurückzuführen. Dieser Prozess ist als chemische Verwitterung bekannt. Bislang ist es der Wissenschaft noch nicht gelungen, die Mechanismen dieses Prozesses genau zu messen oder vollständig zu verstehen. Das vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) finanzierte Projekt ROC-CO2 hat bahnbrechende neue Analysemethoden entwickelt, um einen besseren Überblick über die chemische Verwitterung zu erhalten.
CO2-Emissionen messen
„Die Messung der CO2-Freisetzung aus dem Gestein erweist sich als sehr schwierig“, erklärt ROC-CO2-Projektkoordinator Robert Hilton von der Universität Oxford(öffnet in neuem Fenster) im Vereinigten Königreich. „Wir wissen allerdings, dass bei der Zersetzung von Gestein einige Elemente in die nahe gelegenen Flüsse und Seen gelangen.“ Eines dieser Elemente ist Rhenium, das, wie Hilton bemerkt, als Instrument für eine annähernde Bestimmung des Kohlenstoffs dienen könnte. Durch die Entnahme von Flussproben und die Analyse des Rheniumgehalts konnten Hilton und seine Forschungsgruppe einen Überblick über den Gesteinsabbau in einem bestimmten Gebiet erstellen und messen, wie schnell dieser Prozess abläuft. Hilton und sein Team versuchten dann, die CO2-Emissionen und die CO2-Absorption durch Gesteinsverwitterung direkt zu beziffern. „Wir haben an unserem Standort in Frankreich CO2-Sensoren an Felsen angebracht und beobachtet, wie die Felsen ‚atmeten‘“, beschreibt Hilton. „Das war viel schwieriger, als es sich anhört, denn wir mussten sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht durch CO2-Emissionen aus der Atmosphäre oder aus Pflanzenwurzeln verfälscht werden.“ Zu diesem Zweck wurden Gasproben entnommen und der Radiokohlenstoffgehalt ermittelt. Da die Halbwertszeit von Radiokohlenstoffisotopen(öffnet in neuem Fenster) Tausende Jahre beträgt, erlangte das Team durch einen negativen Messwert die Gewissheit, dass das CO2 aus einer nicht lebenden Quelle, d. h. aus Gestein, stammte.
Klimaauswirkungen
Über einen Zeitraum einiger Jahre wurde im Projekt geschlussfolgert, dass die Menge an CO2, die bei der Gesteinsverwitterung freigesetzt wird, tatsächlich mit der Temperatur zunimmt. Im Winter gingen die CO2-Emissionen der Messumgebung zurück, im Sommer stiegen sie an. „Dies ist ein Hinweis darauf, dass bei einer Klimaerwärmung mehr CO2 freigesetzt wird“, fügt Hilton hinzu. „Sollte das auch auf Orte außerhalb unserer Messumgebung zutreffen, dann sollten wir einige Aspekte unseres Denkens über den Kohlenstoffkreislauf ändern.“ Für Hilton haben die Projektergebnisse neue Forschungsmöglichkeiten eröffnet. „Wir können uns nicht aussuchen, wann und wo der natürliche Kohlenstoffkreislauf CO2 in die Atmosphäre entweichen lässt“, sagt er. Unter Permafrost liegt zum Beispiel Sedimentgestein. „Wird es CO2 ausstoßen, wenn der Permafrost zurückgeht? Das müssen wir herausfinden.“ Die Methoden von ROC-CO2 werden inzwischen von anderen Forschenden auf der ganzen Welt übernommen. Ihre Ergebnisse werden dazu beitragen, das Bild darüber zu vervollständigen, wie sich CO2-Flüsse aus sich zersetzendem Gestein wahrscheinlich auf das Klima auswirken werden, und zwar auf einer Zeitskala, die von einer Saison bis zu Tausenden Jahren reicht.