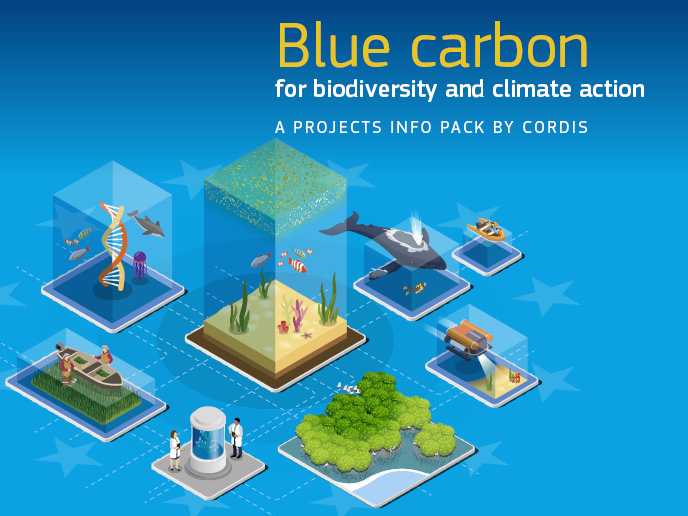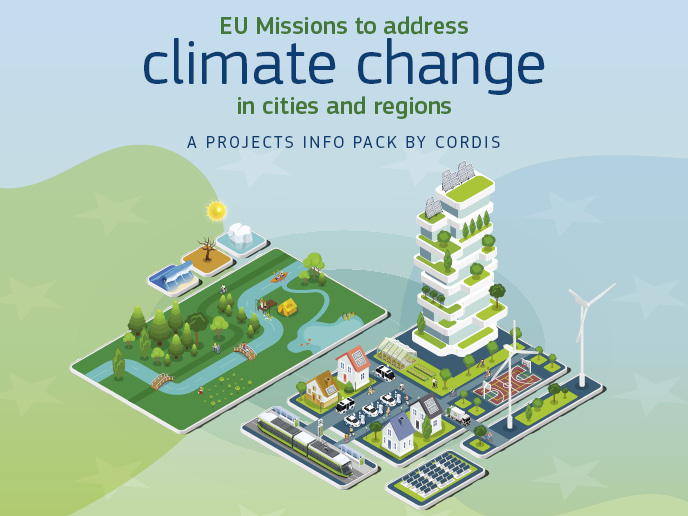Untersuchung der Auswirkungen des Abtauens von Permafrost auf den Stickstoffkreislauf
Thermokarst(öffnet in neuem Fenster) entsteht dort, wo eisreicher Permafrost abtaut. Während der gefrorene Boden langsam auftaut, schmelzen die oft mehrere Meter breiten Eiskeile schnell. Dieses rasche Abschmelzen kann den Boden zum Einsturz bringen, was an der Küste zu Erosion führt oder im Landesinneren zahlreiche Vertiefungen bildet, die sich mit Wasser füllen (z. B. kleine Seen).
Thermokarstprozesse und globale Erwärmung
Thermokarstprozesse wirken sich jedoch nicht nur auf die arktische Landschaft aus – sie können auch Auswirkungen auf den Klimawandel haben. „Im Permafrost sind abgestorbene Pflanzenreste und damit auch organischer Kohlenstoff und Stickstoff eingeschlossen“, erklärt Nicolas Valiente von der Universität Kastilien-La Mancha(öffnet in neuem Fenster) in Spanien, Projektstipendiat des Projekts NITROKARST(öffnet in neuem Fenster). „Permafrostböden enthalten einen der weltweit größten Pools an organischem Kohlenstoff und globalem Stickstoff. Wenn die Böden und Boden-Eis-Gemische auftauen, sind die komplexen organischen Stoffe verfügbar und die Mikroorganismen werden aktiv und bauen diese Verbindungen ab. Infolgedessen produzieren sie Treibhausgase, die die Klimaerwärmung verstärken: Kohlendioxid, Methan und Distickstoffmonoxid.“ Das Projekt NITROKARST, das von der Universität Wien(öffnet in neuem Fenster) in Österreich koordiniert und über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) unterstützt wird, soll helfen, die zugrunde liegenden Mechanismen des mikrobiellen Stickstoffkreislaufs in thermokarstgeschädigten Böden besser verstehen. „Distickstoffmonoxid ist ein Treibhausgas mit einem 273-mal(öffnet in neuem Fenster) höheren Erwärmungspotenzial als Kohlendioxid“, sagt Valiente. „Mikroorganismen gewinnen Energie aus Stickstoff, der bei der Zersetzung von organischem Material freigesetzt wird, und produzieren bei ihrem Stoffwechsel Distickstoffmonoxid. Wir wissen immer noch nicht genau, wie diese Prozesse in Thermokarstlandschaften ablaufen.“
Probenahme in der kanadischen Arktis
Um dieses Geheimnis zu lüften, reisten Valiente und sein Team für zwei Wochen in die kanadische Arktis, genauer gesagt nach Inuvik in den Nordwest-Territorien, wo sie Feldforschung betrieben. In dieser Zeit wurden Bodenproben aus verschiedenen Tiefen und in unterschiedlichen Stadien des Thermokarstprozesses entnommen. „Am Western Arctic Research Centre(öffnet in neuem Fenster) in Inuvik tauten wir einige dieser Proben über mehrere Tage auf, um das natürliche Abtauen zu simulieren“, so Valiente. „Dann setzten wir den Proben Proteine mit markiertem Stickstoff zu und inkubierten sie in luftdichten Behältern.“ Nach einigen Tagen analysierte das Projektteam die Proben, um mikrobielle Umwandlungen festzustellen. Außerdem wurden Proben zur weiteren Analyse nach Wien gebracht.
Besseres Verständnis von Stickstoffrecyclingprozessen
„Unsere ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Stickstoffrecyclingprozesse mit der Tiefe und dem Fortschreiten der Thermokarststadien variieren“, erklärt Valiente. „In der aktiven Schicht (der obersten Schicht des Bodens, die im Sommer abtaut), wo die Verfügbarkeit von Stickstoff begrenzt ist, scheinen Mikroorganismen ihn eher aufzunehmen und zu immobilisieren.“ Im Permafrost, wo größere Stickstoffvorräte vorhanden sind, wird der Stickstoff dagegen hauptsächlich für Mineralisierung(öffnet in neuem Fenster) verwendet. „Obwohl wir in unseren 9-tägigen Experimenten keine signifikante Distickstoffmonoxid-Produktion nachweisen konnten, kann mineralisierter Stickstoff als Energiequelle genutzt werden, was zur Distickstoffmonoxid-Produktion als Nebenprodukt mikrobieller Prozesse führt“, so Valiente. Ein besseres Verständnis der mikrobiellen Prozesse, die hier ablaufen, hat die Tür zu weiteren Forschungen geöffnet. Ein wichtiger nächster Schritt, so Valiente, wird darin bestehen, die für die Stickstoffumwandlung verantwortlichen Mikroorganismen mithilfe von genomischen(öffnet in neuem Fenster) Techniken zu identifizieren. „Es wäre zudem wertvoll zu untersuchen, ob die Distickstoffmonoxid-Produktion als Nebenprodukt anderer Prozesse in abtauenden eisreichen Permafrostregionen (die zu Thermokarst neigen) auf lange Sicht von Bedeutung ist“, schließt er.