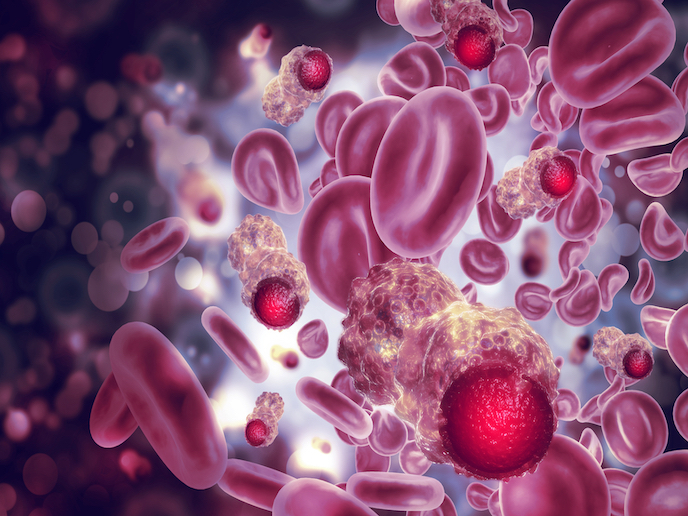Zelluläre Tore, von Membranen und Stoffwechsel geformt
Kernporenkomplexe (nuclear pore complexes, NPCs) sind molekulare Maschinen, die in die den Zellkern umschließende Membran eingebettet sind. Sie dienen als hochselektive Tore, durch die bestimmte Moleküle wie RNS, Proteine und Signalfaktoren in den Kern hinein- und hinausgelangen können, während sie andere davon abhalten. „Dieser streng regulierte Verkehr ist für die Genexpression und die zelluläre Entscheidungsfindung unerlässlich“, erklärt der Koordinator des Projekts NPC-BUILD, Alwin Koehler(öffnet in neuem Fenster) von der Medizinischen Universität Wien(öffnet in neuem Fenster). „Ohne Kernporenkomplexe wäre die genetische Information im Zellkern vom Rest der Zelle abgeschnitten.“
Analyse des nukleären Korbs
Eine wichtige Komponente des Kernporenkomplexes ist jedoch nach wie vor geheimnisvoll – der nukleäre Korb. Dabei handelt es sich um eine flexible, tentakelartige Struktur, die in den Zellkern hineinreicht und den Kernporenkomplex mit der inneren Kernmembran verbindet. „Wir wussten nicht, wie sich dieser Korb zusammensetzt, wie er haften bleibt oder wie er die Funktion des Kernporenkomplexes beeinflussen oder sogar umprogrammieren könnte“, sagt Koehler. „Es war auch sehr wenig darüber bekannt, aus welchen Lipiden diese Membran besteht und ob sie das Verhalten der Kernporen beeinflussen.“ Das vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) geförderte Projekt NPC-BUILD sollte klären, ob und wie der nukleäre Korb an der inneren Kernmembran verankert ist und ob der Lipidstoffwechsel an der inneren Kernmembran deren Aufbau und Funktion direkt beeinflusst. Um dies herauszufinden, kombinierte das Projekt Strukturbiologie mit Live-Cell-Imaging, synthetischer Biologie und Lipidbiochemie. Zu den Innovationen gehörten die Rekonstruktion des Aufbaus der Kernporenkomplex-Körbe mit Hilfe künstlicher Membranen, die Anwendung der 3D-Elektronenmikroskopie und die Entwicklung neuartiger Biosensoren zur Visualisierung des Lipidstoffwechsels an der inneren Kernmembran in Echtzeit in lebenden Zellen. „Mit diesen Instrumenten konnten wir nicht nur die Architektur des Kernporenkomplex-Korbs analysieren, sondern sie auch im metabolischen und physikalischen Kontext der Kernmembran verstehen“, fügt Koehler hinzu.
Verständnis von Struktur und Funktion des Kernporenkomplexes
Für Köhler ist die wichtigste Erkenntnis, dass Struktur und Funktion des Kernporenkomplexes eng mit dem Lipidstoffwechsel an der inneren Kernmembran verwoben sind. „Einige Entdeckungen führten uns zu dieser Schlussfolgerung“, erklärt er. „Wir haben herausgefunden, dass der Grad der Lipidsättigung – also wie starr oder flüssig die Membran ist – den Aufbau und die Stabilität der Kernporenkomplex-Körbe stark beeinflusst. Wir konnten auch zeigen, dass die innere Kernmembran stoffwechselaktiv ist. Sie beherbergt nicht nur passiv eingebettete Proteine, sondern reguliert auch aktiv die Produktion und Speicherung von Lipiden.“ Das Projektteam identifizierte Nup60 als wichtiges Verankerungselement des Kernporenkomplex-Korbs, das wie ein Tragseil wirkt und den Korb an der inneren Kernmembran befestigt. Diese Wechselwirkung ist lipidabhängig und stellt eine direkte molekulare Verbindung zwischen der Lipidumgebung und dem Aufbau des Kernporenkomplex-Korbs her.
Kernporenkomplexe als lipid-empfindliche Strukturen
Das Projekt NPC-BUILD hat gezeigt, dass Kernporenkomplexe nicht nur Proteinmaschinen sind, sondern lipid-empfindliche Strukturen, die in eine stoffwechselaktive Membran eingebettet sind und von dieser geformt werden. „Der Lipidstoffwechsel ist bei vielen Krankheiten wie Krebs, Neurodegeneration und vorzeitiger Alterung gestört“, bemerkt Koehler. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass solche Störungen direkte Auswirkungen auf den Kerntransport, die Genregulation und die Integrität des Genoms haben können – und zwar über den Kernporenkomplex.“ Der Kernporenkomplex-Korb, der früher als passives Anhängsel betrachtet wurde, entpuppt sich somit als dynamischer Sensor und Integrator des physikalischen und metabolischen Membran-Zustands. Dies eröffnet neue Denkmöglichkeiten im Hinblick auf die Art und Weise, wie Zellen Wachstum, Stressreaktionen und Stoffwechselanpassungen koordinieren. „In diesem Projekt haben wir Instrumente entwickelt, die es anderen ermöglichen werden, Kernmembranen auf dynamische, integrative Weise zu erforschen“, meint Koehler. „Wir haben auch dazu beigetragen, über die Kernhülle neu nachzudenken – nicht als statische Barriere, sondern als lebendige, anpassungsfähige Schnittstelle zwischen Zellstoffwechsel und Genregulation.“