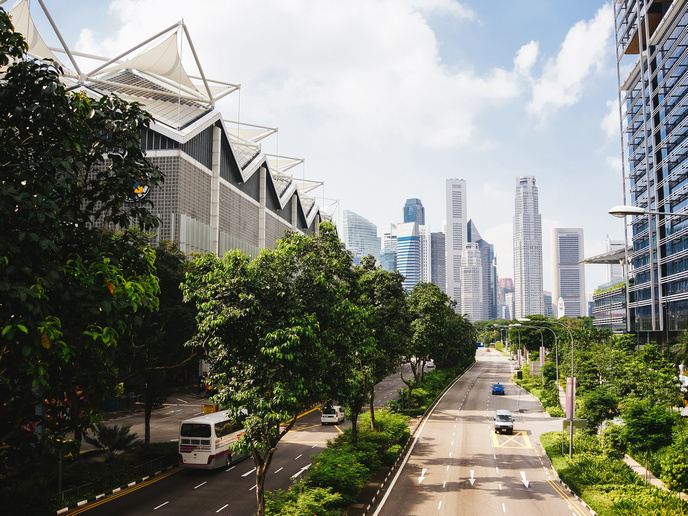Unterwasserlärm und seine Auswirkungen auf das aquatische Leben verringern
Neben der Belastung durch Schadstoffe wie Mikroplastik leidet das aquatische Leben auch unter den schädlichen Auswirkungen von Unterwasserlärm (URN) – also Schallenergie, die von Schiffen und Booten freigesetzt wird. „Da die meisten Wassertiere Schall für lebenswichtige Funktionen nutzen, kann die Exposition gegenüber URN ihre Kommunikation, Nahrungsaufnahme, Navigation/Wanderung und ihr Fortpflanzungsverhalten stören“, sagt Gerry Sutton(öffnet in neuem Fenster) vom University College Cork, Projektkoordinator des EU-finanzierten Projekts SATURN(öffnet in neuem Fenster).
Problem quantifizieren und Lösungen finden
Die Forschenden von SATURN profitierten von Laborexperimenten und Feldstudien, die hilfreich waren, um die gefährlichsten Wassergeräusche sowie deren kurz- und langfristige Auswirkungen auf Wirbellose, Fische und Meeressäugetiere zu ermitteln. Anschließend führten die Ingenieure Hunderte von physikalischen Modellversuchen durch, um auf Tausenden von numerischen Simulationen basierte theoretische Ansätze zur Lärmreduzierung zu validieren. So konnten beispielsweise hochmoderne Miniatur-Sender, die an Meeressäugern angebracht wurden, verfolgen, wo, wann und wie Wildtiere Schiffsgeräuschen ausgesetzt sind. Auch ihre Verhaltensreaktionen wurden aufgezeichnet. Um die Auswirkungen von URN (sowohl akut als auch kumulativ) auf repräsentative Wasserarten zu beurteilen, entwickelte das Projekt innovative Laborgeräte: AquaVib(öffnet in neuem Fenster) für Wirbellosenstudien und das MIGRADROME(öffnet in neuem Fenster) zur Bewertung der Auswirkungen auf Wanderfische. Diese Bemühungen ermöglichten es den SATURN-Biologen, die Evidenzbasis über die Auswirkungen von URN um empfindliche Arten in wichtigen taxonomischen Gruppen zu erweitern. Unter Verwendung dieses Wissens erforschten Schiffsingenieure und Schiffsarchitekten anschließend vielversprechende Lösungsansätze zur Schadensbegrenzung im Labormaßstab und im Modellmaßstab. „Optimierte Propellerblattformen sowie Lufteinspritzsysteme, die entlang des Rumpfbodens und am Propeller verlaufen, zeigten vielversprechende Ansätze im Hinblick auf eine Lärmreduzierung.“ „Leitschaufeln und Kanäle vor und um die Propeller herum zeigten ebenfalls Wirkung“, fügt Sutton hinzu. Einige davon werden nun im neuen EU-finanzierten Projekt LOWNOISER unter operationellen Bedingungen mit einer Auswahl an Handelsschiffen im vollen Umfang demonstriert.
Festlegung der Standards für zukünftige Arbeiten
Entscheidend für die Entwicklung des Projekts waren die Standards für Terminologie, Methodik, Werkzeuge und Kennzahlen zur Messung, Bewertung und zum Vergleich der Auswirkungen von Lärm durch Schifffahrts- und Bootsverkehr. Dies beinhaltete auch die räumliche Kartierung der Partikelbewegung und die Definition von Standards für Schallexpositionsexperimente, um sicherzustellen, dass die Laborergebnisse auf die Allgemeinbevölkerung übertragen werden können. Aus den streng kontrollierten Schiffsgeräusch-Feldmessungen durch das Team wurden bedeutende Ergebnisse erzielt, die der Entwicklung des neuen URN-Messstandards für Flachwasserfahrzeuge, ISO 17208-3(öffnet in neuem Fenster), zugrunde gelegt wurden. Ein weiterer bemerkenswerter Erfolg war die Quantifizierung der Unterschiede zwischen den Quellpegelbewertungen, die von den verschiedenen Stellen durchgeführt wurden, die die Schallprofile eines Schiffes zertifizieren – beispielsweise Bureau Veritas(öffnet in neuem Fenster) und DNV(öffnet in neuem Fenster). Das Team zeigte, wie stark diese von den ISO-Standardprofilen abweichen können, was die aktuellen Bemühungen zur Harmonisierung der Methoden(öffnet in neuem Fenster) unter der Schirmherrschaft der International Association of Classification Societies(öffnet in neuem Fenster) veranlasste. „Unser Paket standardisierter Schallsignale ebnet den Weg für konsistentere und vergleichbare Ergebnisse bei der Anwendung in wichtigen Schallexpositions-Experimenten. Dies bietet ein besseres Verständnis der Dosis-Wirkungs-Beziehungen und führt letztendlich zur Bestimmung kritischer Rauschschwellen“, erklärt Sutton.
Volle Kraft voraus – nur leiser
Die Arbeit von SATURN legt die technische, finanzielle und operative Machbarkeit der Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des akustischen Fußabdrucks der Schifffahrtsindustrie dar und unterstützt direkt die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie(öffnet in neuem Fenster) der EU – insbesondere die Erreichung eines guten Umweltzustands. Darüber hinaus gelang es dem Team, URN in die Meeresraumplanung(öffnet in neuem Fenster) (Marine Spatial Planning) zu integrieren, indem es ein interaktives Online-Tool entwickelte, das Klangmodellierung und Geoinformationssysteme kombiniert – unter Verwendung risikobasierter Ansätze. Auf diese Weise sollen die kumulativen Auswirkungen menschlicher Belastungen bewertet und Minderungsmaßnahmen skizziert werden. Die detaillierten Ergebnisse des Projekts wurden auch dem Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt(öffnet in neuem Fenster) der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation mitgeteilt. Sie stellen einen wichtigen Teil des Beitrags der EU zur laufenden „Phase des Erfahrungsaufbaus zur Reduzierung von URN“ dar.