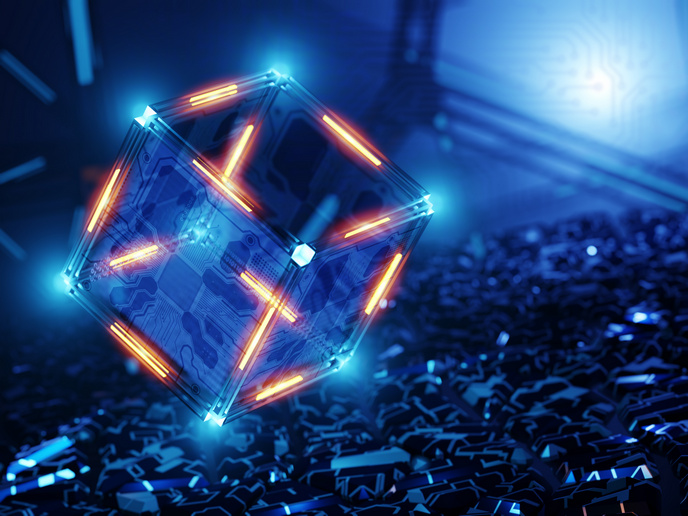Cybercar-Forschung
Man stelle sich die urbane Umgebung ohne Lärm, Verschmutzung und die Gefahren des Straßenverkehrs vor – ein friedvoller Platz, der sämtliche Annehmlichkeiten bietet. Die Kehrseite hiervon wäre, aufgrund der Beschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs nicht in der Lage zu sein, sämtliche Orte innerhalb kurzer Zeit erreichen zu können. Die Lösung dieses Problems war einst Stoff für Science-Fiction-Filme: das kybernetische Auto. Ein kleines fahrerloses Elektroauto, das auf Nachfrage zur Verfügung steht sowie sich in einer geschützten Infrastruktur geringer Dichte fortbewegt und sich nur etwas über das Straßenniveau erhebt. Die Mitglieder des von der EU finanzierten Cybercars-Projekts, einer Forschungsgemeinschaft aus Universitäten, Elektrofahrzeugherstellern sowie Experten aus dem Bereich Navigationssysteme, stimmen voll und ganz der Tatsache zu, dass das Cybercar die Lösung des städtischen Verkehrsproblems ist. Das autonome gesteuerte Fahrzeug bietet sämtliche Annehmlichkeiten ohne die Nachteile der umweltschädlichen Privatautos und könnte unsere Städte revolutionieren. Die Forscher des Projekts Cybercars hatten zum Ziel, die Entwicklung eines kybernetischen Fahrzeugnetzes nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch für den Frachtverkehr zu beschleunigen. Die städtischen Bereiche wären sicherer und die Gesellschaft zudem weniger stark vom Öl abhängig. Die Städte könnten so für die Wirtschaft wie auch für die Einwohner attraktiver werden, denn von beiden Seiten wird ein höherer Umweltschutz gefordert. Verbesserungen technischer Funktionen, die bereits im Planungs- oder Prototypenstadium sind, standen im besonderen Fokus des Projekts. Zu solchen Funktionen gehören Sicherheitssysteme wie Kollisionsschutzsysteme und Techniken zur Realisierung von Konvois, bei denen sich die Fahrzeuge in festem Abstand zueinander in Gruppen bewegen. Anhand von Forschungsbemühungen konnte bereits nachgewiesen werden, dass dies ein Weg ist, die Dichte des Straßenverkehrs zu erhöhen und gleichzeitig die Komplexität der Verkehrssteuerung zu vereinfachen und die Lenkbarkeit des Verkehrs zu verbessern. Kurz gesagt, Verkehrsstaus gehören der Vergangenheit an. Bezüglich der Infrastruktur erforschten die Wissenschaftler Mensch-Maschine-Schnittstellen, das Energiemanagement sowie die Bedienung aus der Ferne. In Lausanne in der Schweiz fand ein Feldversuch statt, um sämtliche Parameter und Systeme zu überprüfen. Hier wurden Lösungen zu möglichen Problemen gesucht, das Hauptproblem waren rechtliche Beschränkungen bei der Zertifizierung der Systeme. Informationen werden über eine Webseite (https://cordis.europa.eu/project/id/IST-2000-28487/de – in englischer Sprache), während Konferenzen oder in Workshops an Interessierte weitergegeben, um den neuen Systemen eine Chance auf Umsetzung in den europäischen Städten zu gewähren. Zukünftig ist ein System denkbar, wo ein Privatfahrzeug in das Cybercar-Netzwerk integriert werden kann. Die Ausnutzung der Vorteile der kontrollierten Sicherheitssysteme in Verbindung mit der menschlichen Intelligenz in einem Hybridsystem könnte für viele Benutzer das Beste aus diesen beiden Welten hervorbringen. Das Forscherteam des Cybercars-Projekts stellt sämtliche Technologien bereit, die erforderlich sind, damit das Cybercar eine wichtige Option zur Ergänzung der Nahverkehrssysteme wird. Mit Unterstützung von Entscheidungsträgern könnte es zukünftig möglich sein, dass ein kurzer Trip durch die Stadt für den Fahrer nicht länger besonders stressreich ist und zudem auch nicht zur Umweltverschmutzung beiträgt.