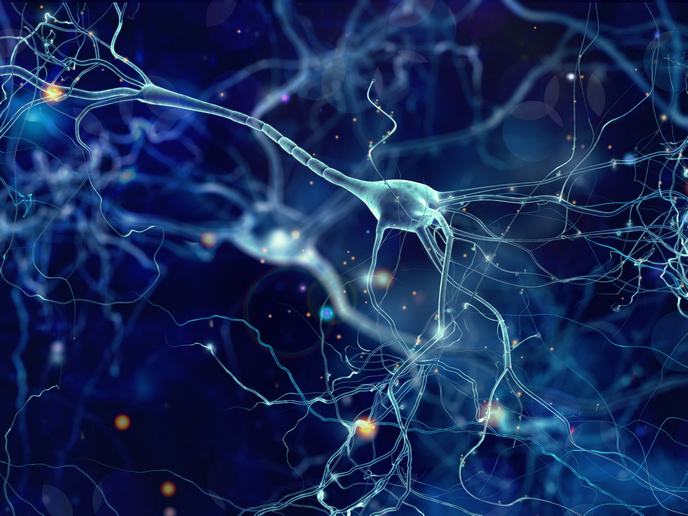Genetische Augenerkrankung in neuem Licht
Ein Forscherteam des EU-finanzierten Projekts RODCELL (Cellular and molecular mechanisms of the light response in photoreceptor cells of the mammalian retina) untersucht die intrazellulären Signalprozesse in Stäbchen und Zapfen von Photorezeptoren. An einem Mausmodell werden die genetischen Mutationen erforscht, die letztlich zur Netzhautdegeneration führen. Primär sollte geklärt werden, wie das Licht in den Photorezeptoren der Säugernetzhaut weitergeleitet wird, und welche Rolle diese für Zellfunktion und Überlebensfähigkeit spielen. Forscher kombinieren hierfür Genanalysen an Mäusen mit morphologischen, biochemischen und elektrophysiologischen Analysen. Sie generierten bereits ein Mausmodell mit einer Untergruppe von Mutationen in den zu untersuchenden Genen. Den Partnern zufolge könne das Mausmodell auch als Prototyp zur Erforschung weiterer Erkrankungen der Netzhaut dienen, die auf autosomal dominant vererbte Mutationen zurückzuführen sind. Autosomal bedeutet, dass das Gen, das die Mutation trägt, auf einem der Autosomen (Chromosomenpaar 1 bis 22) liegt. In der Vererbungslehre heißt "dominant", dass eine Mutation nur auf einem der beiden Allele eines Gens vorhanden sein muss, damit das jeweilige Merkmal ausgeprägt wird, wie es beispielsweise bei dieser Form der Netzhauterkrankung der Fall ist. Erste Ergebnisse legen nahe, dass die mutierten Gene und die Mutationen Toxizität herbeiführen können, da das Protein nicht mehr ordnungsgemäß zu den Außensegmenten der Stäbchen transportiert und nicht mehr korrekt gefaltet wird. So akkumuliert es sich und führt zu Proteotoxizität, die den stressbedingten Zelltod (Apoptose) auslöst. Weiteres Ziel des Projekts RODCELL ist nun, die Stressreaktion in diesem transgenen Signalweg zu charakterisieren.