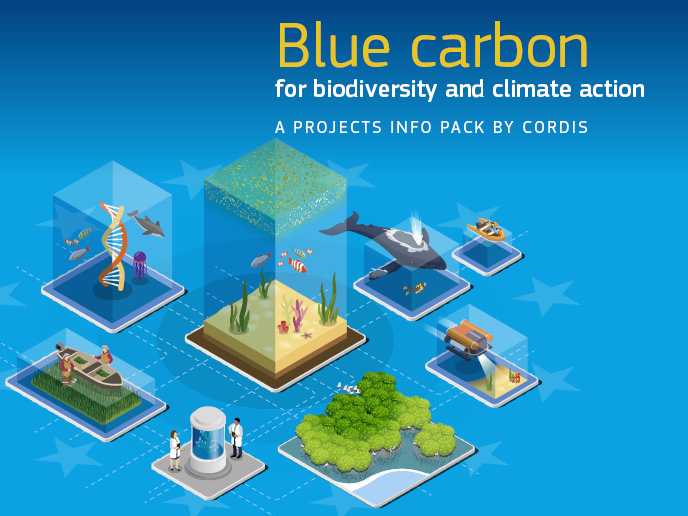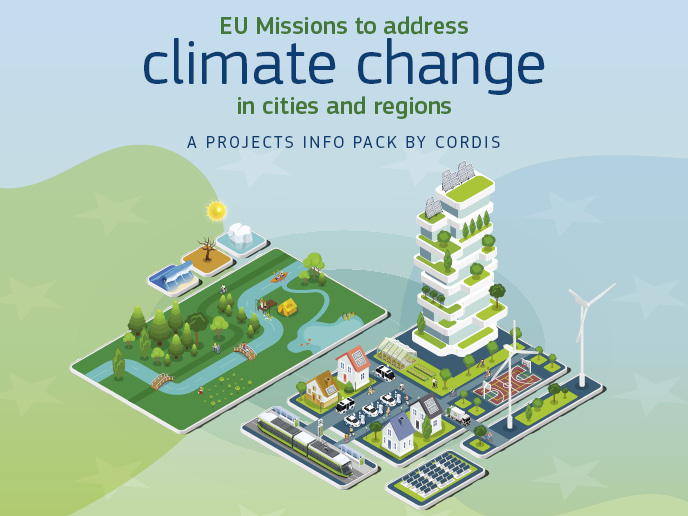Die Ökologie der Pest
Die Pest im 14. Jahrhundert, auch Schwarzer Tod genannt, verbreitete sich von Zentralasien aus nach Europa und tötete schätzungsweise 30 - 60% der europäischen Bevölkerung im Mittelalter. Die zweite Pest-Pandemie brachte immer wieder aufflammende Ausbrüche von Beulenpest und Lungenpest bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Pesterreger, das flohgetragene Bakterium Yersinia pestis, wird von befallenen Nagetieren auf den Menschen übertragen. In Europa tritt die Pest zwar nicht mehr auf, aber in Amerika, Asien und Afrika kommt sie noch vor. Für das von der EU finanzierte Projekt PLAGUEECO2GENO analysierten die Forscher die historischen klimatischen und ökologischen Bedingungen von Pestepidemien und nutzten dabei ihr Wissen über die Dynamik aktueller Nagetierplagen. Sie suchten nach Zusammenhängen zwischen wilden Nagetierpopulationen mit der Krankheit (wie man sie im mittelalterlichen Europa vermutet) und den Tausenden von Pestausbrüchen, wie sie in mittelalterlichen Aufzeichnungen dokumentiert wurden. Aus Vergleichen dieser Aufzeichnungen mit mittelalterlichen Klimainformationen auf der Basis von Jahresringen schlossen sie, dass es keine Anzeichen für ein dauerhaftes europäische Krankheitsreservoir bei wilden Nagern gab, obwohl es möglich ist, dass sowohl wilde als auch Nagetiere transiente Reservoirs bildeten. Überraschend wurde ein klimaabhängiger Faktor für Pestausbrüche im mittelalterlichen Europa gefunden, und zwar in Zentralasien: Klimasensitive asiatische Nagetierreservoirs trugen wahrscheinlich zu mehreren europäischen Ausbrüchen des Schwarze Todes bei und nicht nur zu einem einzelnen Ereignis, wie bisher angenommen. Diese Studie unterstreicht, wie kurzfristige Klimaschwankungen durch ihre Auswirkungen auf regionale Krankheitsreservoirs bei Tierpopulationen als treibende Kraft von Krankheitsausbrüchen über einen Kontinent hinweg fungieren können.