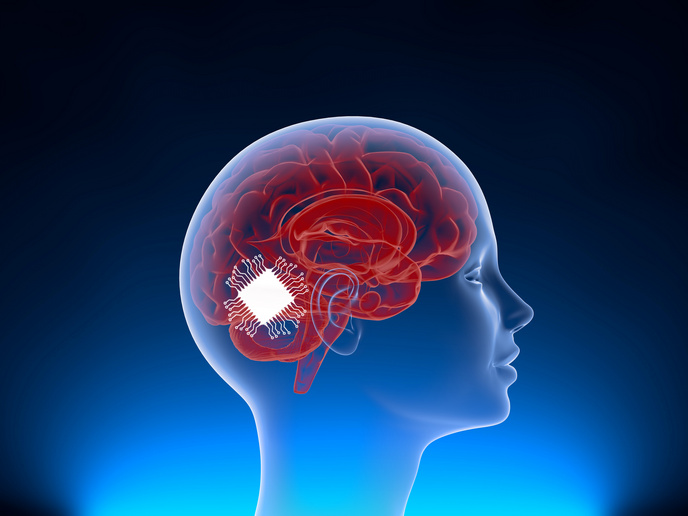Gehörlose Kinder, die Gebärdensprache erlernen, können räumliche Relationen besser wiedergeben als normal hörende Kinder.
Das Gehirn nimmt ständig räumliche Informationen auf, gleich, ob man zum Auto rennen, das Telefon beantworten oder neben einem Fahrzeug herlaufen muss. Normalerweise werden räumliche Relationen zwischen Gegenständen mithilfe von Sprache vermittelt, was sich allerdings verändert, wenn Gebärdensprache verwendet wird. In der Gebärdensprache werden räumliche Relationen vor allem ikonisch (bildhaft) vermittelt und sind weniger abstrakt als bei gesprochener Sprache. Somit befasste man sich intensiv mit dem Spracherwerb, um herauszufinden, ob eine universelle Prozessabfolge auf Basis einer angeborenen Spracharchitektur und nach einheitlichem Konzept stattfindet. Um diese Frage zu klären, verglich das EU-finanzierte Projekt LANGUAGE IN OUR HAND (Language in our hand: The role of modality in shaping spatial language development in deaf and hearing children) das Erlernen gesprochener Sprache und von Gebärdensprache am Fallbeispiel der türkischen Gebärdensprache. Die Studie mit gleichaltrigen gehörlosen und normal hörenden Kindern untersuchte, ob Gebärdensprache die Entwicklung behindert, beschleunigt oder keinen Effekt hat, und berücksichtigte auch die Gestik. Gearbeitet wurde mit statischen und dynamischen Zuständen (z.B.: das Buch liegt auf dem Tisch, die Katze springt in einer Kiste herum, der Junge versteckt den Ball unter dem Bett). Die Testergebnisse bei verschiedenen Altersgruppen zeigten, dass normal hörende Kinder Standortrelationen (in, auf, unter) nach ähnlichem Muster verstehen wie gehörlose Kinder, und dass gehörlose Kinder mit Zuordnungsbeschreibungen aus Betrachterperspektive (links-rechts) sogar besser umgehen als normal hörende Kinder. Außerdem konnten Kinder, die Gebärdensprache nutzten, ähnlich wie Erwachsene Bewegungsereignisse beschreiben (das Mädchen ging zum Auto). Weitere Projektergebnisse bestätigen, dass bei tauben Kindern keine Einschränkung bei räumlichem Lernen besteht (anders als bisherige Studien suggerieren) und sie mitunter sogar besser abschneiden als hörende Kinder, was ebenfalls der gängigen Lehrmeinung entgegensteht. Dies liefert neue Erkenntnisse zur Gebärdensprache wie auch zur Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten und räumlichem Sprachverständnis. Auf diese Weise könnten räumliches Sprachverständnis sowohl bei gehörlosen wie auch normal hörenden Kindern leichter vermittelt werden und gehörlose Menschen besser in die Gesellschaft integriert werden. Sie könnten Gebärdensprache und gesprochene Sprache erlernen (durch bimodalen zweisprachigen Unterricht), um die kindliche Entwicklung weltweit zu fördern.