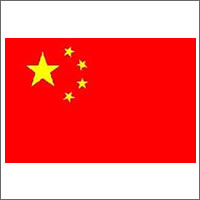China auf dem Weg zur Wissenschafts-Supermacht
China ist auf dem besten Wege, dank massiver öffentlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) und einem enormen Pool an Wissenschafts- und Technologiearbeitskräften zu einer Wissenschafts-Supermacht zu werden. Der Aufstieg aber könnte durch das starre politische System des Landes und "wissenschaftliches Fehlverhalten" behindert werden, warnte ein kürzlich veröffentlichter Bericht des britischen Think Tank Demos. Der Bericht mit dem Titel "The Atlas of Ideas: mapping the new geography of science" (Der Atlas der Ideen: Eine Karte der neuen Geographie der Wissenschaften) bietet Informationen über das Tempo der wissenschaftlichen Innovationen in den Schwellenländern China, Indien und Südkorea. So beschreibt der Bericht die Schlüsselfaktoren der zunehmend soliden Forschungsbasis in China, wozu auch die öffentlichen Mittel gehören. "Derzeit befindet sich das Land in einer Frühphase des ehrgeizigsten Forschungsinvestitionsprogramms seit John F. Kennedy den Wettlauf zum Mond startete", erläutern die Autoren des Berichts. Seit 1999 sind die F&E-Investitionen in China jedes Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. 2005 lagen sie bei 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) - gegenüber 0,7 Prozent im Jahr 1998. Bis zum Jahr 2020 will das Land bis zu 2,5 Prozent des BIP für Forschung ausgeben. Im Dezember 2006 hatte China laut Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Japan zum ersten Mal überholt und ist so nach den USA zum weltweit zweitgrößten F&E-Investor aufgestiegen. Gleichzeitig, so der Bericht, kämpfen die Länder in Europa hart, um das Lissabon-Ziel - 3 Prozent des BIP - zu erreichen. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor für die wissenschaftliche Innovationskraft Chinas ist der schier unerschöpfliche Pool an wissenschaftlich ausgebildeten Arbeitskräften. Dem Bericht zufolge schließen jedes Jahr 4,2 Millionen Studenten an chinesischen Universitäten ein Studium ab - viermal so viel wie Mitte der 1990er Jahre: Ein Großteil dieser Absolventen belegte Fächer in den Bereichen Wissenschaft, Ingenieurwesen und Informatik. Insgesamt gibt es derzeit 2,25 Millionen Wissenschaftler und Ingenieure in China. Darüber hinaus sind zahlreiche Wissenschaftler, die das Land während und nach der Kulturrevolution verlassen haben, in ihre Heimat zurückgekehrt. Der Bericht schätzt, dass im Verlauf der letzten fünf bis sechs Jahre aus den vereinzelten Rückkehrern ein gleichmäßiger Strom geworden ist: Ungefähr 170 000 Menschen sind heimgekehrt, angezogen von einer Mischung aus Loyalität zu ihrem Land, Familienbande und Anreize der Regierung. Als Folge eines aufgefüllten Pools an gut ausgebildeten Wissenschaftlern konnte China eine deutliche Zunahme der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Zitierungen verzeichnen. Rein quantitativ ist der Beitrag Chinas steil angestiegen: Von etwa 2 Prozent weltweit im Jahr 1995 auf etwa 6,5 Prozent im Jahr 2004, im Vergleich zu 35 Prozent in den EU15, das heißt in den 15 EU-Mitgliedstaaten vor der Erweiterung im Jahr 2004. Die Anzahl der Patentanträge ist seit 2000 jährlich um 23 Prozent gestiegen. Der Bericht geht davon aus, dass diese aggregierten Zahlen jedoch die eigentlichen Stärken der chinesischen Forschungsbasis verschleiern. Einer neueren Analyse der nanowissenschaftlichen Veröffentlichungen zufolge rangiert China heute weltweit auf Platz 3, direkt hinter Japan und mit einigem Abstand zu den USA. Darüber hinaus sagen die nationalen Zahlen wenig über die starken Leistungen einzelner Universitäten aus. In einer Untersuchung rangierte die Universität Peking in dem obersten einen Prozent der Institutionen weltweit in Bezug auf Zitierungen in den Bereichen Physik, Chemie, Ingenieurwesen, Materialwissenshaften, Mathematik und klinische Medizin. Fünf weitere chinesische Universitäten waren in mindestens einem dieser Bereiche im obersten einen Prozent. Doch trotz der vielen Belege, dass China schnell und hoch aufsteigt, findet der Bericht auch einige Schwächen in dem derzeitigen System. Die größte Herausforderung, so der Bericht, liege darin, das System zu öffnen und Menschen und Ideen Freizügigkeit zu gewähren. "Kreativität hängt am Ende von Offenheit ab und von der Freiheit, diskutieren und auch unterschiedliche Meinungen vertreten zu können", schreiben die Autoren des Berichts. "Weitere Reformen des Bildungs- und des politischen Systems sind notwendig, aber wenn man auf 1,3 Milliarden Köpfe zurückgreifen kann, dann waren die Aussichten für chinesische Innovationen noch nie besser." Ein weiterer kritischer Faktor für den Erfolg Chinas ist die Führung und Regulierung der Forschungsbasis des Landes. Verschiedene Fälle von substanziellem Plagiat und wissenschaftlichem Fehlverhalten haben das Ministerium für Wissenschaft und Technologie dazu veranlasst, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, unter anderem die Schaffung eines speziellen Büros für Forschungsintegrität, harte Strafen für Plagiate und für die Verfälschung von Daten sowie eine Verschärfung des Systems der Projektbewertung. Aber es werde eine Weile dauern, bis diese Maßnahmen greifen, so die Autoren des Berichts, die darauf hinweisen, dass in der Zwischenzeit mehr und bessere Allianzen zwischen chinesischen Wissenschaftlern, Ethikern und Politikern und deren Kollegen im Ausland geschmiedet werden müssten. Davon würden beide Seiten profitieren, heißt es in dem Bericht. Ein Beispiel einer erfolgreichen Ethik-Allianz ist das von der EU geförderte Projekt BIONET. Es bringt Natur- und Sozialwissenschaftler sowie Praktiker aus China und Europa zusammen und ermöglicht den Ideenaustausch und die Entwicklung gemeinsamer Ansätze für die Regulierung der Biomedizin. Ziel des Netzwerks ist die Unterstützung gemeinsamer Forschung, die Politikberatung und die Kapazitätsbildung der Teilnehmer für die Behandlung ethischer Fragen, die in ihrer Arbeit auftauchen. Dem Koordinator von BIONET Nikolas Rose zufolge will sich das Netzwerk zunächst zwei Bereichen widmen: Stammzellenforschung und Pharmakogenetik. Die Bemühungen, den ethischen Rahmen zu harmonisieren, sollten, so Rose, nicht dazu führen, dass "China die europäischen Werte auf Kosten der eigenen ethischen Traditionen und Kultur aufgezwungen werden".
Länder
China