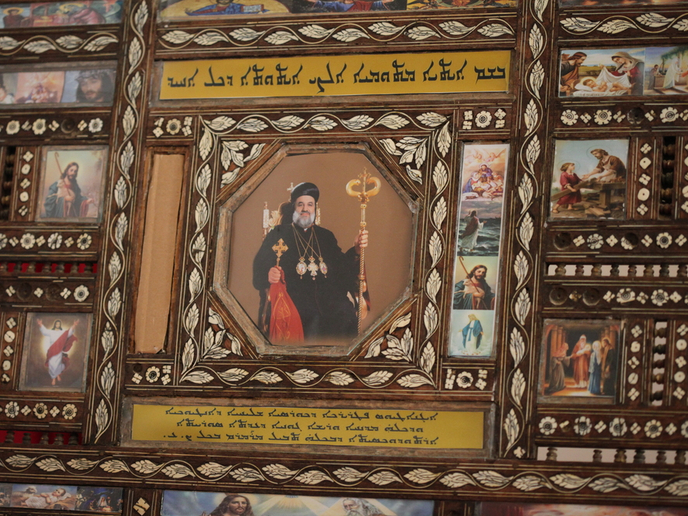Rekapitulation europäischer Geschichte anhand von Edelsteinen
„Inspiriert wurden wir bei unserem Projekt von einer außergewöhnlichen Persönlichkeit der europäischen Geschichte: Karl von Luxemburg, König von Böhmen und Römischer Kaiser“, erklärt Gervase Rosser, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Oxford(öffnet in neuem Fenster), Vereinigtes Königreich, und Projektkoordinator von POMOC. „Er wirkte um die Mitte des 14. Jahrhunderts, einer Zeit des Umbruchs, als die Pest in Westeuropa wütete und sich der religiöse Schwerpunkt von Rom weg nach Avignon verlagerte.“
Neuinterpretation kultureller Vorstellungen
Als 1346 die Krone Böhmens(öffnet in neuem Fenster) an Karl überging, wollte dieser in Böhmens neuer Hauptstadt Prag das Paris seiner Jugendzeit und das antike kaiserliche Rom verschmelzen und wiederaufleben lassen, was im Umbau der Kathedrale in originaler französischer Gotik resultierte, ausgeführt von deutschen Handwerkern. „Die von Karl in diesem neuen Zentrum gegründete Universität besaß starke Anziehungskraft für Wissenschaftler aus dem gesamten westlichen Christentum“, bemerkt Gervase Rosser. „Dies verdeutlichte einerseits die Bedeutung der nationalen böhmischen Identität, aber auch der kosmopolitischen, proto-europäischen Identität.“ Unterstützt durch die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) führte die Marie-Curie-Stipendiatin Ingrid Ciulisová im Rahmen von POMOC eine neue Studie zum kulturellen Verständnis Karls IV. durch, die von Gervase Rosser betreut wurde. Anlass für die Studie war, dass die bestehende Forschung in den letzten beiden Jahrhunderten vermehrt nationalistischen Einflüssen unterlag. „Akademischer Stolz und Neid waren ein starkes Hindernis, das Wirken Karls unter neutralem Gesichtspunkt zu betrachten, denn im tschechischen Nationalismus galt Karl in erster Linie als ‚böhmisch‘“, erklärt Gervase Rosser. „Obwohl Karl echtes Interesse für die böhmische Kultur zeigte, die er auch förderte, weist Ingrid Ciulisová zu Recht auf seinen breiteren kulturellen Horizont hin, der in keiner Weise durch nationalistische Ideen geprägt war, denn diese kamen erst im 19. Jahrhundert auf.“
Geschichtsschreibung in Edelsteinen
Der fromme Karl IV. legte eine beeindruckende Sammlung heiliger Relikte an, die Besucherinnen und Besuchern der Burg Karlštejn vor den Toren Prags immer noch zugänglich sind. Schwerpunkt für Ingrid Ciulisová war hingegen die vom König bzw. Kaiser angelegte Edelsteinsammlung, die nicht weniger beredte Aussagen über sein kulturelles Verständnis zulässt. „Dass antike Edelsteine – in geschliffener Form oder als Kameen(öffnet in neuem Fenster) – von den Handwerkern des Mittelalters aufgearbeitet und wiederverwendet worden waren, ist zwar bekannt“, so Rosser, „allerdings wurde dies bislang in nur wenigen Studien detailliert untersucht.“ So ist etwa ein Goldkreuz, das Karl dem Aachener Dom (der Grabstätte seines kaiserlichen Vorgängers Karls des Großen) stiftete, mit mehreren dieser Edelsteine verziert, u. a. eine klassische Kamee mit dem Abbild eines früheren Kaisers. Karl verwendete die kostbaren Stücke auch als Siegel, Schmuck oder trug sie als – vielleicht schützendes – Amulett. „Unter den Gelehrten, die unter dem Schutz des Kaisers standen, war auch Petrarca(öffnet in neuem Fenster), der Karl eine Sammlung antiker Münzen mit den Portraits klassischer Kaiser vermachte“, sagt Rosser. „Der Dialog zwischen beiden dürfte spannend gewesen sein: ein westeuropäischer Kaiser, der von einem Humanisten über das Zusammenspiel von Ikonographie, Macht und Verantwortung beraten wird.“ Nur wenige kleine Edelsteine, die noch erhalten sind, können sicher Karl IV. zugerechnet werden. Gervase Rosser zufolge konnte Ingrid Ciulisová jedoch die Besonderheit dieser exquisiten Objekte für die Forschung begründen. „Die Steine tragen spezifische neue Erkenntnisse zur Geschichte Europas bei“, so Rosser, und zwar „über ein Europa, das nationale Grenzen überschritt und dessen kulturelles Erbe seit langem sowohl vom Christentum als auch von der Antike geprägt ist.“