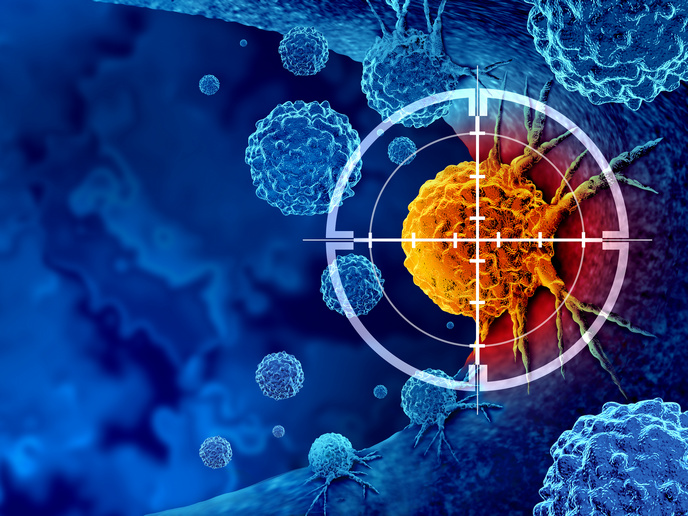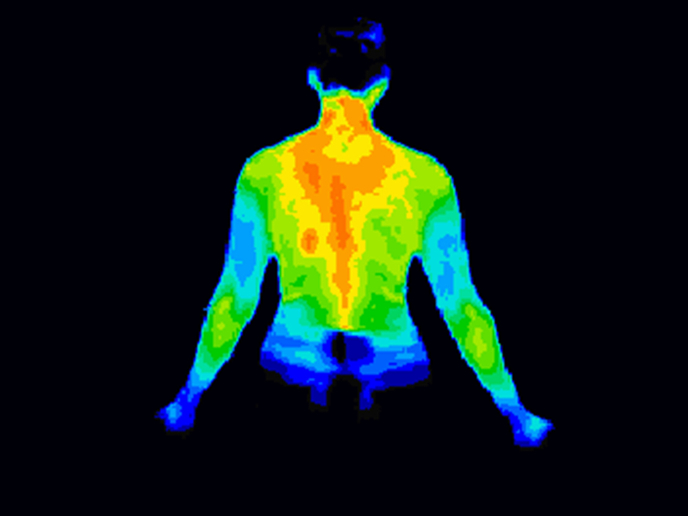Evolutionsforschung mittels Systembiologie
Die nächste Generation von Biologen wird Kenntnisse aus Entwicklungsbiologie, Bioinformatik, funktioneller Genomik und Evolutionsbiologie vereinen. Hierfür müssen während der Ausbildung verschiedenste Fachgebiete übergreifend zusammengeführt werden. Das Projekt 'Evolution of gene regulatory networks in animal development' (EVONET) baute ein Ausbildungsnetzwerk für die Anwendung systembiologischer Ansätze zur Erforschung der Entwicklungsgeschichte von GRN. Ein wichtiges Ziel dieser Ausbildung war die Zusammenführung von GRN-Daten aus unterschiedlichen Tiersystemen aller relevanter Linien mit Schwerpunkt auf der Spezifizierung des Mesoderms und der Regionalisierung des Kopfes. Das EU-finanzierte Ausbildungsnetzwerk aus acht europäischen Arbeitsgruppen vermittelte Forschern die wichtigsten Kompetenzen beim Einsatz modernster Systembiologie, Genomik und Bioinformatik für neue Modellorganismen. Auf diese Weise sollen umfassende und robuste Daten zu GRN in den unterschiedlichen Tiermodellen generiert werden, u.a. in Wirbeltieren, Seeigeln, Seeanemonen, Fruchtfliegen, Polychaeten (Würmern), Tausendfüßern, Manteltieren und Plattwürmern. Die Hauptaufgabe war, Organismen des gesamten Tierreichs zu vergleichen, um konservierte und abweichende Knoten und GRN-Komponenten mit gleichen Entwicklungsregulatoren zu identifizieren. Genomweite Analysen zeigten, dass der Transkriptionsfaktor Brachyury auf eine große Gruppe konservierter Gene in Seeanemone und Frosch abzielt, deren Evolution sich vor 600 Millionen Jahren voneinander trennte. Im Zusammenhang mit der Kopfregionalisierung wurden neue Gene aus Tausendfüßern isoliert und auf ihre Expressionsmuster während der Entwicklung untersucht. Die vergleichende Genexpressionsanalyse zeigte ein Muster, das zwischen Tausendfüßern und Drosophila konserviert ist und damit auf ein sehr altes Herkunftsmuster der Kopfregionalisierungs-GRN in Arthropoden hindeutet. Die Forscher entdeckten Hunderte von Genen, die spezifisch für pluripotente Stammzellen und möglicherweise für die Regenerationsfähigkeit zuständig sind. Vor allem die Gensignatur von Stammzellen in Planarien (nichtparasitischen Flachwürmern) ist denen menschlicher pluripotenter Stammzellen sehr ähnlich, so dass sie möglicherweise als stammzellbiologisches Modell dienen könnten. Die Projektergebnisse wurden bereits in sieben Beiträgen veröffentlicht. Das Netzwerk vermittelte Nachwuchsforschern essentielle Kompetenzen beim Einsatz modernster systembiologischer, genomischer und bioinformatischer Werkzeuge für die Generierung neuer Modellorganismen.