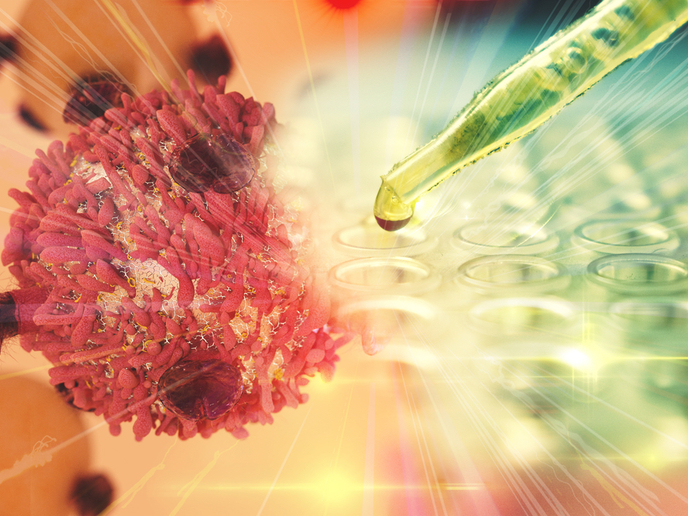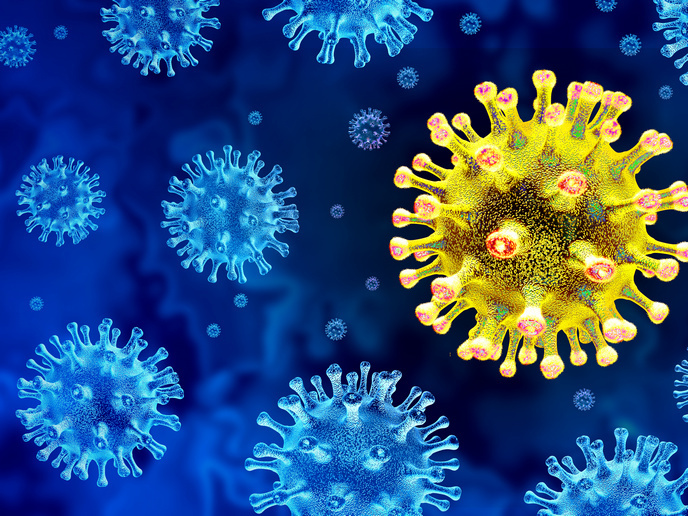Neurologische Erkrankungen durch Videospiele mit Blickverfolgung erkennen
Erkrankungen des Nervensystems machen 28 % der Krankheitslast in Europa(öffnet in neuem Fenster) aus. Eine Diagnose in den frühen Phasen, zum Beispiel bei Demenz, ist jedoch nicht einfach. Effektivere Diagnosewerkzeuge könnten die Therapie erheblich verbessern.
Lumbalpunktion
Die Diagnose von Demenz umfasst üblicherweise eine ausführliche Befragung durch eine Neurologin oder einen Neurologen und kann auch einen PET-Scan oder eine Lumbalpunktion beinhalten. Zwar sind diese Möglichkeiten zuverlässig, allerdings sind sie teuer und kosten sowohl die Betroffenen als auch die medizinischen Fachkräfte viel Zeit. „Oftmals wird eine Diagnose erst gestellt, wenn die Symptome eindeutig sind. Dann ist es jedoch zu spät, um etwas zu unternehmen“, erklärt Laszlo Bax, der Projektkoordinator von MindTrack. „Bei leichteren kognitive Störungen dauert unser Test fünf Minuten und hat eine Genauigkeit von 93 %.“ Braingaze(öffnet in neuem Fenster), das von Bax mitbegründete Unternehmen, hat ein Diagnosewerkzeug entwickelt, das mithilfe von Blickverfolgungstechnologie zahlreiche neurologische Erkrankungen erkennen kann. „Zu Beginn widmeten wir uns ADHS bei Erwachsenen und fanden deutliche Unterschiede in den Mustern bestimmter Augenbewegungen, die kognitive Prozesse widerspiegeln“, so Bax. Anschließend untersuchte das Unternehmen neurodegenerative Erkrankungen, wobei ähnliche Unterschiede in den Augenbewegungsmustern von gesunden und betroffenen Erwachsenen festgestellt werden konnten.
Anstrengungen des gesamten Ökosystems
Die erste Phase der Geschäftsentwicklung von MindTrack wurde durch EU-Finanzmittel unterstützt. „Durch diese Förderung haben wir ein besseres Verständnis dafür erhalten, wie sich das System in die klinische Praxis integrieren lässt“, so Bax weiter. Auch die fortlaufende Zusammenarbeit mit Konzernen, KMU, medizinischen Fachkräften und Krankenhäusern erfuhr dadurch Unterstützung. Dazu sagt Bax: „Das war und ist eine gemeinsame Anstrengung des gesamten Systems.“ Die Spiele sind für ihn „täuschend einfach“: Bei einem muss die Patientin oder der Patient auf einen Frosch starren, während andere Tiere auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms auftauchen. Bei einer Kaulquappe muss die Person reagieren, bei einem Fisch nicht. Jede Aufgabe dauert ein paar Sekunden; insgesamt sind es 120. „Man muss sich auf die Mitte konzentrieren, die kognitive Aufmerksamkeit jedoch auf die Seiten richten“, erklärt Bax. „Die Loslösung der beiden Aufgaben ruft die Augenbewegung hervor, die für uns von Interesse ist.“
Softwareanwendung
Im Erfolgsfall werden neben Neurologinnen und Neurologen auch andere Angehörige der Gesundheitsberufe kognitive Störungen diagnostizieren können, wodurch der Zugang zu Behandlungen verbessert wird. „Wir möchten eine objektive Erkennung kognitiver Störungen ermöglichen, die nutzungsfreundlich und kostengünstig ist“, merkt Bax an. „Jetzt müssen wir eine Datenbank entwickeln, um die KI-Algorithmen zu trainieren, damit diese die Krankheit automatisch erkennen können. Mithilfe der zusätzlichen Daten müssen wir die medizinischen Fachkräfte außerdem überzeugen, dass das, was wir haben, funktioniert.“ Durch die EU-Unterstützung konnte Braingaze die Technologie außerdem als unabhängiges Softwareinstrument testen. Sollte sich dies als erfolgreich erweisen, könnte der Test auch über handelsübliche Smartphones und Tablets angeboten werden, was die Kosten weiter senken und den Zugang erheblich verbessern würde. „Das erarbeiten wir jetzt für die zweite Phase“, sagt Bax. „Wir haben gezeigt, dass es möglich ist. Jetzt müssen wir das Prinzip nur noch in ein Produkt umwandeln, das auf allen Hardwareplattformen funktioniert.“