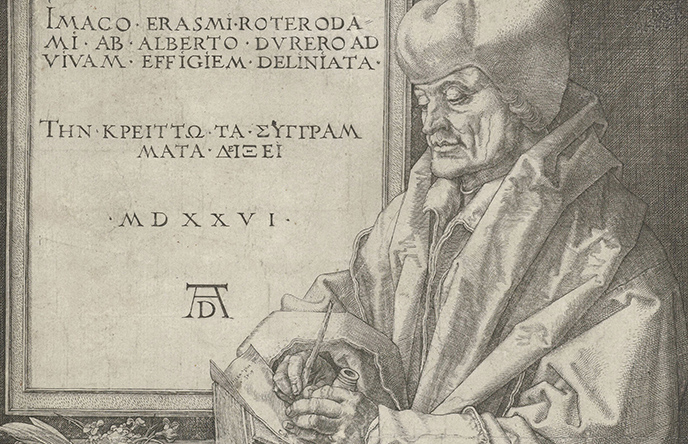Innovative Datenbank erleichtert Forschenden das Studium des Antiquarismus in der Renaissance
Unter Antiquarismus versteht man das Studium der antiken Zivilisationen, bei dem in der Regel Texte und Dokumente als Quellen dienen. Da die Altertumswissenschaft jedoch manchmal auch nicht-literarische Materialien wie Kleidung verwendet, überschneidet sich das Feld ein wenig mit der Archäologie, die frühere Zivilisationen meist anhand physischer Artefakte untersucht. Die Renaissance war eine ungenau definierte Periode in der europäischen Geschichte, die in etwa vom 14. bis zum 17. Jahrhundert dauerte. Dies war eine spannende Zeit der europäischen Wiederentdeckung verlorenen Wissens aus der klassischen griechisch-römischen Epoche. Viele Merkmale, die das moderne Leben bestimmen, wurden erstmals während der klassischen Periode eingeführt, darunter die Demokratie, öffentliche Bibliotheken, formale Logik und Gelehrsamkeit. Antiquarismus in der Renaissance ist das Studium früherer Zivilisationen, das in der Zeit der Renaissance betrieben wurde. Moderne Wissenschaft auf dem Gebiet des Antiquarismus in der Renaissance examiniert die Erkenntnisse der Renaissance-Gelehrten zum Thema klassische europäische Zivilisation.
Neue Datenbank-Ressource
Das Problem ist, dass eine solche Untersuchung nicht leicht zu bewerkstelligen ist. Die Quellenmaterialien sind verstreut. Deshalb hat das EU-finanzierte Projekt ATRA(öffnet in neuem Fenster) eine digitale Ressource für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelt. Diese zeichnet die Zirkulation antiquarischer Gelehrsamkeit im Europa der Renaissance nach. „Es soll dazu beitragen, neues Wissen über antiquarische Studien während der Renaissance zutage zu fördern“, erklärt Projektkoordinator Dr. Riccardo Drusi. „Es soll außerdem zeigen, wie dem antiquarischen Ansatz – der Quellen und empirische Belege dokumentiert – eine zentrale Rolle in der Entwicklung des gesamten kulturellen/intellektuellen Lebens der Frühneuzeit zukam.“ Der Begriff „Atlas“ im Titel des Projekts bezieht sich auf den europäischen geographischen Raum. Er signifiziert nicht eine Kartierung. Diese Forschung wurde mit Unterstützung der Marie Skłodowska-Curie-Maßnahmen durchgeführt. Nutzende der ATRA-Datenbank(öffnet in neuem Fenster) sind wissenschaftliche Gelehrte, die sich mit der klassischen Antike, der Kulturgeschichte der Renaissance und der klassischen Epigraphik (Inschriften aus der Antike), sowie mit Archäologie und Religionsgeschichte befassen. Die Materialien der Datenbank können bequem von der Nutzergruppe abgerufen und studiert werden. Sie bestehen hauptsächlich aus Briefwechseln zwischen Intellektuellen der Renaissancezeit. In diesen Briefen werden Probleme im Zusammenhang mit der historischen Rekonstruktion der klassischen Zivilisation erörtert.
Was haben die Gelehrten der Renaissance erkundet?
Bis heute hat keine Ressource es modernen Gelehrten ermöglicht, schnell festzustellen, welche Renaissance-Gelehrten bestimmte Themen untersuchten. Die ATRA-Datenbank ermöglicht jedoch eine Suche anhand mehrerer Begriffe, die sich auf die recherchierten Themen und die Personen, welche die Diskussionen führten, beziehen. Die Fragen, die moderne Forschende stellen, scheinen zum Teil rätselhaft. „Zum Beispiel“, fügt Drusi hinzu, „wie lautet der moderne Artenname der Pflanze, die Plinius beschreibt? Wie wurde die Waffe gebaut, die in den Quellen als ‚arubalista‘ bezeichnet wird?“ In diesen Fällen können die Antworten anhand der Diskussionen ermittelt werden, die unter den Florentiner Philologen (Gelehrte für Sprachen und antike Texte) im späten 16. Jahrhundert geführt wurden. Auch stärker evaluative Nachforschungen sind möglich, etwa die Frage, auf welchem Weg genau Hannibal die Alpen nach Italien überquerte. Ein Ergebnis der ATRA-Studie war es, die Intensität des Interesses an der klassischen Welt zur Zeit der Renaissance sichtbar werden zu lassen. Ein anderes war, neue Materialien ans Licht zu bringen, die verifiziert werden müssen, bevor sie in die Datenbank aufgenommen werden können. Das Projekt ATRA verfolgte keine kommerziellen Ziele. Die meisten geisteswissenschaftlich Geschulten glauben, dass Wissen einen Eigenwert besitzt. Zumindest wird die neue Datenbank den Forschenden dabei helfen, das Thema auf bequemere Art und Weise zu untersuchen und zu entwickeln.