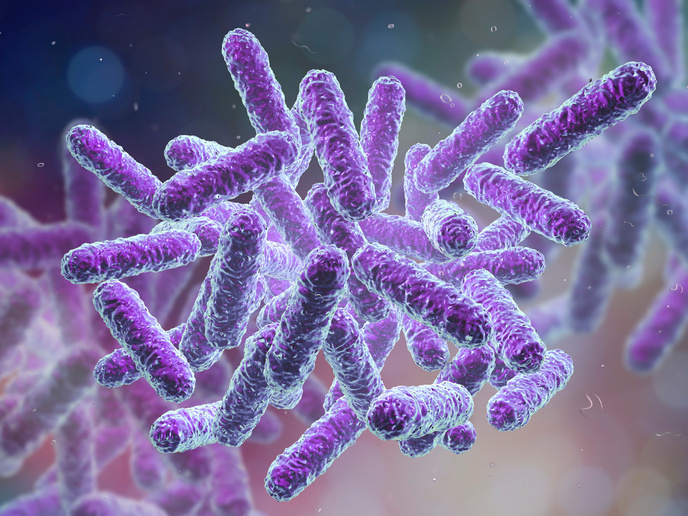Wirkung von Antibiotika auf menschliche Darmflora
Antibiotika sind zwar zur Behandlung von Infektionskrankheiten unerlässlich, können aber auch die im Gastrointestinaltrakt (GIT) heimischen lebenswichtigen Bakterienkulturen aus dem Gleichgewicht bringen. Ein besonders unerwünschter Effekt der langfristigen Antibiotikatherapie ist die antibiotika-assoziierte Diarrhö (AAD). Zudem kann Selektionsdruck Antibiotikaresistenzen hervorrufen, die das Überlegen der widerstandsfähigsten schädlichen Bakterien sichern. Noch ist unklar, welches Bakterium für AAD verantwortlich ist. Durch das Absterben kommensaler (also mit dem Darm in Symbiose lebender) Bakterien können pathogene Bakterien die Oberhand gewinnen. Insbesondere Clostridium difficile (C. difficile) proliferiert unter solchen Umständen und setzt Toxine frei, die Entzündungen, Durchfall und Darmentzündungen (Colitis) verursachen. Das EU-finanzierte Projekt AMIDIM untersuchte die Effekte einer Langzeitantibiotikatherapie auf die menschliche Gesundheit sowie die genaue Rolle von C. difficile in der komplexen gastrointestinalen Ökologie. AMIDIN führte die Untersuchungen an Akne-Betroffenen durch. Diese sind hierfür ideal geeignet, da sie oft eine Langzeittherapie mit Breitbandantibiotika erhalten (häufig Tetrazyklin), allgemein aber gesund sind. Von Vorteil für die Untersuchung ist hier auch, dass Tetrazykline meist nicht vollständig im oberen Magen-Darm-Trakts absorbiert werden und dadurch in höheren Konzentrationen in den Darm gelangen. Die Forscher überwachten Veränderungen der mikrobiellen Diversität als mögliche Ursache für Durchfallerkrankungen. Im Vergleich zu Ergebnissen aus Voruntersuchungen veränderte die Antibiotikagabe die Zusammensetzung der Darmflora, sodass selbst einen Monat nach Abschluss der Behandlung der ursprüngliche Zustand nicht wiederhergestellt war. C. difficile-Bakterien fanden sich hingegen nicht. Mittels DNA-Mikroarrays wurde daraufhin die genetische Ausstattung eines C. difficile-Stamms analysiert, um herauszufinden, ob Eisenverfügbarkeit oder Antibiotika den Genotyp dieses opportunistischen Bakteriums verändert hatten. Tetrazyklin gilt als Eisenchelator, d.h. es geht eine Verbindung mit Eisen ein. Antibiotikatherapien bringen die komplexe Ökologie im menschlichen Darm aus dem Gleichgewicht. AMIDIM wird weiter zur Klärung dieser Mechanismen beitragen, insbesondere, wie GIT-Bakterien dadurch geschädigt werden. Das Projekt untersucht Effekte auf die menschliche Gesundheit und wie es zu Antibiotikaresistenzen kommt.